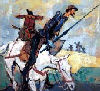
7. Juli 2005 in Chronik
Ein Beitrag von Mariano Delgado / Universität Freiburg / Schweiz
Wie hast Du's mit der Religion?», fragt bekanntlich Gretchen Dr. Faust. Seitdem wird im Deutschen von der «Gretchenfrage » gesprochen, wenn in verschiedenen Kontexten die entscheidende Frage gestellt wird. Auch im Spanischen gibt es einen wichtigen Ausdruck, der auf den Quijote zurückgeht: «Con la Iglesia hemos topado» / «Wir sind an die Kirche geraten» (II:9, 749). Somit gibt man zu verstehen, dass man es mit einer mächtigen Institution zu tun hat und dass es besser gewesen wäre, die eigenen Kräfte vorher gut geschätzt zu haben. Im narrativen Kontext des Quijote hat der Satz aber keine andere Bedeutung als diese: dass Don Quijote und Sancho in der Dunkelheit auf die Mauer der Dorfkirche geraten, als sie um Mitternacht in El Toboso einziehen und nach der Burg Dulcineas suchen.
Quijote als Erasmus-Schüler?
Für einige Forscher ist darin figurativ das ausgedrückt, was Miguel de Cervantes beim Verfassen seines Werkes gerade vermeiden wollte: in den «schweren Zeiten» (Teresa von Avila), in denen er lebte, mit der kirchlichen Institution oder der inquisitorischen Zensur in Konflikt zu geraten. Américo Castro und Marcel Bataillon meinen dann, dass Cervantes ein «aufgeklärter», vom Gedankengut des Erasmus beeinflusster Christ war, dessen Philosophia Christi sowie die Kritik des Klosterlebens und der Volksreligiosität er weitgehend teilte, unter den wachenden Augen der Inquisition aber nur zwischen den Zeilen und mit allerlei Kautelen skizzieren konnte. In der Beschreibung der Frömmigkeit des Ritters im grünen Mantel durch das Bild « eines einfachen, wohlhabenden, frommen und wohltätigen Lebens ohne jeden Schatten der Heuchelei» sehen diese Autoren dann einen Spiegel der Frömmigkeit von Cervantes selbst: «Ich höre täglich die Messe, teile gern mit den Armen, was ich habe, ohne mich meiner guten Werke zu rühmen, um nicht Heuchelei und Eitelkeit in meinem Herzen aufkommen zu lassen, Feinde, die sich unbemerkt auch in dem Besten einnisten. Ich trachte, die Uneinigen zu versöhnen, verehre die heilige Jungfrau und vertraue stets auf die unendliche Barmherzigkeit Gottes, unseres Herrn» (II,16: 810).
Oder als Propagandist Trients?
Für andere Autoren ist Cervantes eher ein Propagandist der Trienter Dekrete (Paul Descouzis) oder ein Volksprediger (Salvador Muñoz Iglesias), der nicht nur den kirchlichen Dirigismus in Glaubens- und Sittenfragen wahrgenommen, sondern aus Überzeugung zur edlen Aufgabe der Evangelisierung des Volkes durch die Literatur beigetragen hat. Ohne jeden polemischen Charakter finden sich dann im Quijote die wichtigsten katholischen Thesen vertreten, die das Trienter Konzil in Abgrenzung zu den Protestanten demonstrativ bejahte: «die Notwendigkeit der guten Werke zum Heil, den sakramentalen Charakter von Ehe, letzter Ölung und Weihe; die Notwendigkeit und den Wert der Beichte; die Legitimität und Zweckmässigkeit des Heiligen-, Bilder- und Reliquienkultes; die Existenz des Fegefeuers und der Nutzen der Suffragien; die Realität des freien Willens und damit zusammenhängend auch des Verdienstes in den menschlichen Handlungen; die Anerkennung der Hierarchie und des Lehramtes der Kirche; die Annahme des Primats des Römischen Hohenpriesters . . .»
Die Klugheit Quijotes
Auf alle Fälle wird man Cervantes bescheinigen müssen, dass er mit den Glaubens- und Sittenfragen im Quijote sehr «klug» umgeht. Wenn er wirklich anders dachte, als er zu verstehen gibt, so hat er sich seine Kritik, wie Don Quijote manchmal seine Tapferkeit, «für bessere Zeiten» (II,28: 935) aufgespart, als die «schweren Zeiten», in denen er lebte - was auch als Zeichen der Klugheit, statt der Heuchelei gedeutet werden könnte: « denn der kluge Mann spart sich für bessere Gelegenheiten auf » (II,28: 934).
Eines steht fest: Angesichts der vielen «Predigten » und religiösen Diskurse im Quijote ist die Bemerkung im Prolog des ersten Teils («. . . denn das Ganze ist ja vielmehr eine Satire auf die Ritterbücher. . .», I, Prolog: 44) eine deutliche Untertreibung, es sei denn, dass wir sie als einen Appell verstehen, die religiösen Diskurse nicht ernst zu nehmen, sondern als Teile eines «Ritterromans» zu betrachten. Aber der Quijote ist mehr als ein blosser Ritterroman: Er ist eher der unterhaltsame und tiefsinnige Bericht der Abenteuer eines fahrenden Ritters, der die messianischen Werte Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit und vor allem Barmherzigkeit in einer Welt hochhält, die andere Wege eingeschlagen zu haben scheint.
Die Tugenden Quijotes
Es fällt zunächst auf, dass der «Ritter von der traurigen Gestalt» unter der ersten Pflicht seines Berufs Folgendes versteht: «den Demütigen Gnade zu verschaffen und die Gottlosen zu züchtigen, das will sagen, den Unglücklichen beizustehen und ihre Bedränger zu vernichten» (II,52: 1157). Ein fahrender Ritter muss Theologe sein, «um über den christlichen Glauben, zu dem er sich bekennt, klare und bündige Auskunft geben zu können, sooft es verlangt wird» (II,18: 832 f.). Und er sollte auch folgende Eigenschaften besitzen: «... keusch sein in seinen Gedanken, züchtig in seinen Worten, freigebig mit seinen Werken, und endlich ein strenger Verfechter der Wahrheit, sollte ihm deren Verteidigung auch das Leben kosten» (II,18: 833).
Darüber hinaus trägt Don Quijote des Öfteren christologische Züge. So nutzt er die tragikomische Episode der Bauern, die mit der Eselsstandarte in den Krieg gegen das Nachbardorf ziehen, um über die Liebe zu den Feinden und die Überwindung der Rache zu sprechen: «ein Gebot, das etwas schwer zu erfüllen scheint, es aber nur für diejenigen ist, die Gott weniger achten als die Welt und das Fleisch höher als den Geist. Denn Jesus Christus, der wahrhafte Gott und Mensch, der niemals eine Unwahrheit sagte noch sie sagen konnte und der unser Gesetzgeber ist, sagte von sich selbst, sein Joch sei sanft und seine Bürde leicht; folglich konnte er uns nicht etwas geboten haben, dessen Erfüllung unmöglich wäre» (II,27: 931 f.).
Demut und Barmherzigkeit
Als Sancho seinen Quersack mit seinem bisschen Hab und Gut verloren hat und verzweifelt war, da sie nun nichts zu essen hatten, tröstet ihn Don Quijote mit diesen evangelischen Worten über die göttliche Vorsehung: «Aber unterdessen steig nur auf und folge mir nach, guter Sancho; Gott, der für alles in der Welt sorgt, wird uns auch nicht verlassen, da wir jetzt so ganz in seinem Dienste wandeln, wie wir es tun. Speist er doch die Mücken in der Luft, die Würmer auf der Erde und die Froschbrut im Wasser, und er lässt in seiner Barmherzigkeit seine Sonne aufgehen über Gute wie Böse und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte» (I,18: 214 f.).
Und als Don Quijote schliesslich dem «Gouverneur » Sancho die Kunst der guten Regierung erläutert, so beschränkt er sich nicht auf die Ermahnung zur Pflege der Gerechtigkeit, sondern erinnert ihn - in geistiger Verwandtschaft zur spirituellen Weite der Mystiker, die an den paulinischen Überschuss der Gnade glaubten -, daran, dass er vor allem Gott nachahmen und barmherzig sein soll: «Musst du einem Schuldigen sein Urteil sprechen . . . erweise dich ihm . . . mitleidig und gnädig, denn obwohl alle Eigenschaften Gottes gleich gross sind, so strahlt und leuchtet doch in unsern Augen seine Barmherzigkeit mehr als seine Gerechtigkeit» (II,42: 1058).
Man könnte weitere Beispiele hinzufügen, aber die erwähnten mögen genügen. Sie zeigen uns, dass die Feder des Geschichtenerzählers Cervantes dem «christlichen Beruf» (II,74: 1356) treu geblieben ist, den er ihr zugewiesen hat. Denn die Lektüre des Quijote ruft in uns die besten und edelsten (auch religiösen) Gefühle wach: Leidenschaft für Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sowie für den Schutz der Bedrängten aller Art.
Subtile Kritik
Aber Cervantes tut dies im Rahmen der paradoxen Verfasstheit seiner Literatur, die oft beide Seiten der Medaille zur Sprache bringt und sich die (legitime) Freiheit nimmt, ironische Spitzen gegen manche Zustände in Kirche und Gesellschaft seiner Zeit zu streuen. So finden wir im Quijote eine subtile Kritik des staatlichen und kirchlichen Nepotismus, die ihre Aktualität nicht verloren haben dürfte: «hat man dabei ein wenig Glück und grosser Herren Gunst, so kann man es, ehe man noch daran denkt, leicht zu einem Richterstab in der Hand oder einer Bischofsmütze auf dem Kopfe bringen» (II,66: 1294). Besondere Aufmerksamkeit verdient die Behandlung der Kleriker und Kirchendiener, die Don Quijote « als guter und treuer katholischer Christ in hohen Ehren » halten möchte (I,19: 223). Hin und wieder finden sich aber ironische Spitzen gegen das Leben der Kleriker, die der Klerikerkritik des einfachen Volkes entsprechen. So wird die gute Ernährung der «Herren Geistlichen » aufs Korn genommen, «denn solche Herren lassen es sich selten schlecht gehen» (II,19: 224; vgl. auch II,60 und II,71). Ähnliches liesse sich über die Ordensleute sagen. Einige, wie etwa die zwei betuchten Benediktiner, die auf Dromedaren daher reiten (I,8), werden dem Spott preisgegeben; andere wiederum, zumeist Angehörige der reformierten Bettelorden wie die barfüssigen Karmeliter (I,32; II,29; II,48) und die Kapuziner (I,11), aber auch die Kartäuser (I,13; II,18; II,49; II,66), kommen sehr gut weg, ja sie werden zumeist bewundert.
Bittere Ironie
Aber wirklich kritisch mit Klerikern und Ordensleuten wird Cervantes, der als ein zweimal Exkommunizierter wirklich gute Gründe dazu gehabt hätte, im Quijote nur an zwei Stellen. So etwa wenn er den Kaplan der Herzöge mit beissender Ironie porträtiert, als würde er dabei an einen jener Kleriker denken, unter denen er persönlich gelitten hat: «ein gravitätischer Geistlicher, einer von denen, die in den Häusern der Fürsten die Herrschaft führen; von denen, die es, da sie nicht als Fürsten geboren, schlecht verstehn, jene, die es sind, zu lehren, wie sie es sein sollten; von denen, die verlangen, dass der Grossen Grosssinn sich ihrem eignen Kleinsinn anschmiege; von denen endlich, die die ihrer Leitung überlassenen Fürsten sich einschränken lehren wollen und sie dadurch zu elenden Knausern machen» (II,31: 959 f.).
An der anderen Stelle, die der Feder Voltaires entsprungen sein könnte, macht sich Cervantes über die Offenheit der Kleriker für das erotische Begehren weltlicher Christen und Christinnen lustig: «Es war einmal eine junge, schöne, freie, reiche und vor allem lustige Witwe, die verliebte sich in einen jungen, handfesten Laienbruder. Der Pater Prior erfuhr davon und sagte eines Tages im Tone brüderlicher Ermahnung zu der wackern Frau: Bedenkt man aber die vielen positiven und die wenigen kritischen Stellen über Kleriker und Ordensleute, so gibt es kaum Anlass zu einer erasmianischen Interpretation derselben nach dem Motto « monachatus non est pietas ». Vielmehr handelt es sich um literarische Pinselstriche, die der allgemeinen Sicht des Volkes auf Kleriker und Ordensleute entsprechen. Für eine Laienreligiosität Man kann sagen, dass Cervantes für eine Laienreligiosität eintritt, die - ohne den Klerikerstand gering zu schätzen - von der allgemeinen Berufung eines Christenmenschen zur Heiligkeit ausgeht. Bezeichnend hierfür ist der Dialog zwischen Don Quijote und Sancho über die Heiligkeit, die für einen Christen letztlich den wahren Ruhm bringt. Als Sancho das Beispiel von zwei barfüssigen Bettelmönchen ins Gespräch bringt, die vor kurzem heilig gesprochen worden waren und deren Reliquien vom Volk sehr verehrt werden, antwortet Don Quijote: «Wir können nicht alle Mönche werden, und Gott hat der Wege viele, um seine Auserwählten zum Himmel zu führen» (II,8: 747). Cervantes behandelt religiöse Themen im Rahmen eines Literaturkonzeptes, das vom kirchlichen Dirigismus in Glaubens- und Sittenfragen ausgeht und sich das löblichste Ziel vorgenommen hat, «das ein Schrifsteller sich setzen kann, nämlich .. . zu gleicher Zeit zu belehren und zu belustigen» (I,47: 619). Mit seiner Option für die messianischen Werte Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zeigt uns Don Quijote einen anderen Weg zur Moderne, als der von Dr. Faust verkörperte, der bekanntlich bereit war, seine Seele zu verkaufen, wenn er damit nur seine Ziele erreichen konnte. Mariano Delgado ist Professor für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte an der Universität Freiburg/Schweiz. 1605: Stanislaus Kostka wird seliggesprochen. Miguel de Cervantes erster Teil von Don Quijote erscheint. Der am 1. April zum Papst gewählte Alessandro Ottaviano de´Medici (Leo XI.) stirbt am 27. April. Am 16. Mai wird Camillo Borghese zum Papst gewählt. Paul V. regiert bis 1621. Der Beitrag erschien in der "Schweizerische Kirchenzeitung . 25/2005" - Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Delgado © 2005 www.kath.net