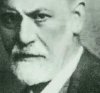
3. Mai 2006 in Interview
Freud hat radikal nach der Wahrheit gefragt, sich aber in Glaubensfragen verheerend getäuscht. Interview mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Martin Grabe.
Oberursel (www.kath.net / idea) Niemand hat die Beurteilung seelischer Vorgänge so beeinflusst wie der vor 150 Jahren geborene jüdische Atheist Sigmund Freud. Er hat versucht, die Tiefen der Seele zu ergründen und unter anderem den Einfluss frühkindlicher Erlebnisse auf das Empfinden und Verhalten des Menschen zu verstehen.
Gleichzeitig war er einer der schärfsten Religionskritiker. Was bleibt von Freud? Darüber sprach idea-Reporter Marcus Mockler mit dem Chefarzt der psychotherapeutischen Abteilung der christlich ausgerichteten Klinik Hohe Mark, Dr. Martin Grabe (Oberursel bei Frankfurt am Main). Der Psychiater und Psychotherapeut ist verheiratet und Vater von vier Kindern.
idea: Herr Dr. Grabe, gibt es aus christlicher Sicht Verdienstvolles an Freud?
Grabe: Sein Lebenswerk ging bei allem, was wir als Christen auch an ihm zu kritisieren haben in die richtige Richtung. Er hat radikal nach der Zwiespältigkeit menschlicher Existenz gefragt dass also auch gute Menschen in sich böse, destruktive Gedanken und Neigungen verspüren können, deren Herkunft sie nicht verstehen. Das finden wir zum Beispiel schon beim Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 7, wo er schreibt, dass er nicht das tue, was er wolle, sondern das ausübe, was er eigentlich hasse. Fachlich gesehen beschreibt Paulus damit einen klassischen Es/Über-Ich-Konflikt. Freud hat mit seinen Modellen die Selbsterkenntnis des Menschen auch im Blick auf seine dunklen Seiten entscheidend vorangetrieben. Aus christlicher Sicht verstehen wir dadurch auch besser, warum wir das Evangelium, warum wir Erlösung brauchen.
idea: Wo müssen Christen Freud am schärfsten widersprechen?
Grabe: Bei seiner Sicht von Religion. Er hat den Glauben bzw. eine Gottesbeziehung ausschließlich als innerpsychisches Geschehen erklärt und eine Existenz Gottes von seinem materialistisch-naturwissenschaftlichen Verständnis her gar nicht erwogen. Was er zur Religion geschrieben hat, bringt uns nicht weiter.
idea: Ist an Freuds Kritik, der Glaube an Gott sei letztlich die Folge des kindlichen Wunsches nach einem guten Vater, denn nicht auch etwas Wahres?
Grabe: Richtig ist: Vaterbeziehung und Gottesbeziehung sind für viele Menschen sehr schwer zu trennen. Das erleben wir bei uns in der Psychotherapie. Wer etwa einen sehr strengen Vater hatte, bekommt oft nur schwer Zugang zu dem liebenden, vergebenden Gott der Bibel. Insofern beschreibt Freud durchaus eine zutreffende Seite der Realität, aber aus Sicht des Glaubens fehlt eben die entscheidende andere: die eigenständige Gottesbeziehung, an der auch schlechte Kindheitserfahrungen heilen können.
idea: Für die meisten Psychologen ist der Glaube an den Gott der Bibel aber weiterhin eher ein Zeichen von geistiger Unreife ...
Grabe: ... an diesem Punkt hat es in den vergangenen zehn Jahren aber einen deutlichen Umschwung gegeben. Es gibt beispielsweise viele Psychotherapietagungen, die von Kliniken und Fachverbänden veranstaltet werden und die sich positiv mit Spiritualität beschäftigen. Bei jungen Psychologen, die heute bei uns ihr klinisches Jahr machen, erleben wir eine Offenheit für den Glauben, die wir früher kaum für möglich gehalten hätten. Es wird inzwischen in der Psychologie längst nicht mehr so abfällig über Religion gedacht wie früher.
idea: Freud hat beim Thema Schuld das Denken stark verändert. Wer Schlechtes tut, wird nicht mehr alleinverantwortlich gemacht, sondern das Verhalten wird auf üble Kindheitserfahrungen und gesellschaftliche Umstände zurückgeführt. Schuld sind die anderen. Ist das mit biblischem Denken zu vereinbaren?
Grabe: In dieser Einseitigkeit natürlich nicht. Aber es gibt umgekehrt auch ideologisch festgelegte Seelsorger, die eben viel zu wenig den Hintergrund berücksichtigen, vor dem ein Mensch aufgewachsen ist und der ihn geprägt hat. Es ist doch ein Unterschied, ob jemand in einem Elternhaus geborgen aufgewachsen ist oder eine Kindheit voller Brutalität und Missbrauch hinter sich hat. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf sein Denken und Handeln. Der Therapeut seinerseits darf den Patienten nicht in die Unmündigkeit führen. Auch ein Missbrauchter ist später verantwortlich für seine Handlungen. Aber das Thema Schuld kommt heute in der Therapie durchaus vor, denn es geht ja auch darum, andere Menschen vor Fehlhaltungen des Patienten zu schützen, zum Beispiel dessen eigene Kinder.
idea: Eine Fülle von Studien kommt letztlich zu dem Schluss, dass psychologische Behandlung kaum wirksam und teilweise sogar schädlich ist beispielsweise nach Katastrophen. Ein weiteres: Wenn die Psychotherapie beansprucht, seelische Probleme erkennen und behandeln zu können wie kommt es dann, dass Psychotherapeuten überdurchschnittlich häufig Alkoholiker sind und überdurchschnittlich häufig geschieden werden? Das bedeutet doch: Die kriegen ihr Leben auch nicht in den Griff.
Grabe: Psychotherapeuten sind beruflich besonders hoch belastet wie Ärzte allgemein statistisch eine deutlich geringere Lebenserwartung als ihre Patienten haben. Psychotherapeuten befassen sich permanent mit schwierigen seelischen Problemen und neigen gleichzeitig dazu, sich selbst zu überfordern. In Folge steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie persönlich Schiffbruch erleiden. Dazu kommt, dass einige auch in diesen Beruf gegangen sind, weil sie Antworten auf eigene seelische Probleme suchen. Manchen Pfarrern geht es da ähnlich: Einige haben Theologie studiert, um sich über ihren eigenen Glauben klar zu werden und nicht, weil sie schon vorher besonders stark im Glauben waren. Das spricht aber keineswegs grundsätzlich gegen beide Berufsgruppen. Was Katastrophen anbetrifft: Es spricht tatsächlich nichts für eine psychologische Begleitung im Sinne eines Debriefings. Wahrscheinlich liegt das daran, dass durch frühe intensive Gruppentherapie Katastrophenopfer daran gehindert werden, ihre eigenen Methoden des Umgangs mit belastenden Erlebnissen anzuwenden etwa dem Ehepartner die Geschichte zu erzählen. Wenn sie in der Gruppe noch die belastenden Geschichten der anderen zusätzlich hören müssen, kann damit das Trauma verstärkt werden.
idea: Psychologie ist für bestimmte Teile der Bevölkerung schon fast eine Ersatzreligion geworden. Andererseits erobert psychologisches Denken auch immer stärker die Kirche, insbesondere in der Seelsorge. Zugespitzt gefragt: Dürfen wir die Beichte durch eine Gesprächstherapie ersetzen?
Grabe: Nein. Die Beichte wird zwar bei Protestanten relativ wenig genutzt, kann aber eine wesentliche Funktion in unserem Glaubens- und Gemeindeleben haben. Wo Schuld besteht, gibt es nichts Befreienderes als den persönlichen Zuspruch der Vergebung durch einen Seelsorger. Das kann Gesprächstherapie nicht leisten.
idea: Wieviel Psychologie braucht dann der Seelsorger?
Grabe: Es ist wichtig, dass Seelsorger in der Lage sind zu erkennen, wo sie es mit einem psychisch Kranken zu tun haben, und diesen dann auch rechtzeitig an einen gut ausgebildeten Psychotherapeuten abgeben.
idea: Und wo wünschen Sie sich in der Kirche mehr Psychologie?
Grabe: In der Vorbeugung gegen das Ausbrennen, gegen den Burnout. Viele Pfarrer denken, je stärker sie Gemeindeglieder aktivieren können, desto erfolgreicher sind sie und desto besser ist ihr Gemeindeleben. Heilsam ist das Gemeindeleben aber nur, wenn man darin auf Dauer gesund bleiben oder vielleicht sogar noch gesünder werden kann. Das ist angesichts mancher Überbeanspruchung von Haupt- und Ehrenamtlichen unmöglich. Mehr psychologisches Wissen und mehr Einfühlungsvermögen wären hier vonnöten.
© 2006 www.kath.net