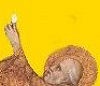
26. März 2010 in Aktuelles
Vor 40 Jahren erschien die offizielle Ausgabe des Missale von Paul VI. Ein Beitrag von Helmut Hoping / DIE TAGESPOST.
Würzburg (kath.net / tagespost) Am 26. März 1970 erschien die offizielle Ausgabe des neuen römischen Messbuchs. Die dazu gehörigen Texte hatte Papst Paul VI. am Gründonnerstag des Vorjahres durch die Apostolische Konstitution Missale Romanum promulgiert.
Das neue Messbuch war das Ergebnis einer Ritusreform, wie es sie zuvor in der Geschichte der katholischen Kirche noch nicht gegeben hatte. Die römische Messe, die in ihrer Substanz mehr als 1 500 Jahre alt ist, hatte sich seit Gregor dem Großen zwar weiterentwickelt; vor allem erfuhr sie seit der Karolingerzeit signifikante Veränderungen.
Nach der Jahrtausendwende war sie aber nahezu unverändert geblieben. Das Missale von 1570, das im Auftrag des Konzils von Trient erschien, brachte insgesamt nur wenig Änderungen. Demgegenüber haben die Eingriffe in die römische Messe im 20. Jahrhundert ihre Gestalt in einem Maße verändert, dass es auf den ersten Blick schwer fällt, die Einheit der tridentinischen Messe und der Messe Pauls VI. zu erkennen.
Von einem Bruch mit der tridentinischen Messe sprechen nicht nur traditionalistische Kreise wie die Piusbruderschaft, sondern auch jene, die in der nachkonziliaren Reform eine Befreiung vom ungeliebten alten Ritus sahen.
So schreibt Joseph Gelineau, Mitglied des Rates zur Durchführung der Liturgiereform, in seinem Buch Die Liturgie von morgen (1979): Man muss es ohne Umschweife sagen: Der römische Ritus, so wie wir ihn gekannt haben, existiert nicht mehr. Er ist zerstört. Mauern aus dem ursprünglichen Gebäude sind gestürzt, während andere ihr Aussehen so sehr verändert haben, dass dieses heute entweder als Ruine erscheint oder als bruchstückhafter Unterbau eines anderen Gebäudes.
Die von der Konstitution Sacrosanctum concilium (1963) beschlossene Reform der Liturgie war Teil des umfassenden Konzilsprogramms des aggiornamento. Gemeint war damit nicht eine Anpassung an den Zeitgeist, sondern Erneuerung in der größeren Tradition der Kirche.
Die Reform hatte ihr primäres Ziel darin, das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen (SC 1). Die Liturgiekonstitution formuliert drei zentrale Prinzipien der Reform. Das erste ist dasjenige der tätigen Teilnahme: Die Mutter Kirche wünscht sehr, alle Gläubigen möchten zu der vollen, bewussten und tätigen Teilnahme an den liturgischen Feiern geführt werden, wie sie das Wesen der Liturgie selbst verlangt (SC 14).
Hier ist vor allem der innere, bewusste Mitvollzug der Liturgie im Blick, nicht die Verteilung einzelner liturgischer Dienste auf möglichst viele Gläubige.
Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Einfachheit und leichteren Verstehbarkeit: Die Riten mögen den Glanz edler Einfachheit an sich tragen und knapp, durchschaubar und frei von unnötigen Wiederholungen sein. Sie seien der Fassungskraft der Gläubigen angepasst und sollen im allgemeinen nicht vieler Erklärungen bedürfen (SC 34).
Intendiert war damit nicht ein ritueller Minimalismus, der vor allem auf schlichte Feierformen setzt. Das Prinzip formuliert die vom Liturgiehistoriker Edmund Bishop unter anderem beschriebene edle Schlichtheit des römischen Ritus im Vergleich zu anderen, vor allem orientalischen Riten.
Kein Bruch mit der alten Messe
Dass die Konzilsväter keinen Bruch mit der überlieferten Liturgie wollten, zeigt das dritte Prinzip der organischen Entwicklung: Bei der Reform seien nicht nur die allgemeinen Gestalt- und Sinngesetze der Liturgie zu beachten; es sollen auch keine Neuerungen eingeführt werden, es sei denn, ein wirklicher und sicher zu erhoffender Nutzen der Kirche verlange es. Dabei ist Sorge zu tragen, dass die neuen Formen aus den schon bestehenden gewissermaßen organisch herauswachsen (SC 23).
Organische Liturgieentwicklung besagt nicht, dass die Entwicklung der Liturgie gleichsam samenhaft im Kern ihres Anfangs angelegt ist oder sich nach inneren Gesetzen vollzieht. Die Liturgie der Kirche gleicht aber einem Organismus, der nicht beliebig verändert werden kann, ohne sein Leben zu gefährden.
Die Messbuchreform hat eine Reihe positiver Früchte hervorgebracht. Zu nennen ist hier als erstes die deutlich sichtbarere Einheit der Messfeier, bestehend aus der Liturgie des Wortes und der eucharistischen Liturgie.
Auch die neue Perikopenordnung, die den Gläubigen die Heilige Schrift reicher erschließen sollte, ist ein großer Gewinn der freilich durch die fragwürdige Erlaubnis, an Sonntagen nur eine der beiden Lesungen nehmen zu können, wieder verspielt wurde. Ebenfalls positiv zu werten ist die Einführung der Volkssprache für die Liturgie des Wortes, die empfohlene und an Sonn- und Festtagen vorgeschriebene Homilie und die Wiedereinführung des Fürbittgebets der Gläubigen.
Eine Bereicherung des Missale stellen ebenfalls die neu hinzugekommenen Präfationen und Orationen dar. Grundsätzlich gilt dies auch für die drei zusätzlichen Hochgebete des Messbuchs Pauls VI. bei allen kritischen Anfragen, die man im Einzelnen formulieren kann, zum Beispiel was das Verhältnis des zweiten Hochgebets zu seiner Vorlage, der Anaphora der Traditio Apostolica, betrifft. Schließlich ist die Kommunion der Gläubigen innerhalb der Messfeier hervorzuheben, auf die schon ohne großen Erfolg das Konzil von Trient gedrängt hatte.
Neben Licht gibt es aber auch Schatten. Zunächst wäre hier auf die wenig überzeugende Eröffnung der neuen Messe zu verweisen. Sah der Novus Ordo Missae von 1965 (in dem viele eine authentische Umsetzung der vom Konzil gewünschten Liturgiereform sahen) noch das Stufengebet in Form der missa dialogata vor, fiel es danach dem immer ungezügelteren Reformeifer zum Opfer.
Unter faktischem Wegfall auch des Introitus trat so an die Stelle des gemeinsamen Betens aus dem Psalter, dem Gebetbuch Israels, die thematische Einführung des Vorstehers in die Messfeier. An sie schließt sich das nun gemeinsam gesprochene Confiteor an, welches mit seinen drei Formen in einem ungeklärten Verhältnis zum Kyrie steht.
Als Verlust ist neben dem Stufengebet auch die fast vollständige Eliminierung der traditionellen Offertoriumsgebete zu werten, vor allem des Gebets Suscipe, sancta Trinitas. Erhalten geblieben ist aus dem Offertoriumskreis neben dem Gebet über die Opfergaben nur die ihm vorangehende Gebetsbitte Orate fratres mit dem nachfolgenden Suscipiat der Gläubigen.
Das Messbuch für die Bistümer des deutschen Sprachgebiets (1975) sieht hier jedoch zwei Varianten vor, die das Orate fratres in der Feier der Messe weithin verdrängt haben.
Einen ungeheuren kulturellen Bruch stellt der fast vollständige Verlust der lateinischen Liturgiesprache für die eucharistische Liturgie dar gegen den Willen der Konzilsväter (SC 36). Problematisch ist auch die Inflation der Hochgebete nach 1970, nicht nur wegen ihrer zum Teil fragwürdigen theologischen und sprachlichen Qualität, sondern weil ein solcher Pluralismus von Eucharistiegebeten für die römische Tradition ganz untypisch ist.
Ein gesondertes Problem ist die Abkehr von der traditionellen Gebetsrichtung ad orientem bzw. Dominum, von der die Konzilsväter noch ganz selbstverständlich ausgingen (SC 33). Die celebratio versus populum, mit ihrer ständigen Beziehung von Angesicht zu Angesicht zwischen Zelebrant und Gläubigen, rückte den Priester in eine herausgehobene Position gegenüber der Gemeinde, die bis dahin unbekannt war.
Obschon die celebratio versus populum bis heute nicht vorgeschrieben ist, sondern nach dem Konzil aus pastoralen Gründen neben der traditionellen Gebetsrichtung erlaubt wurde, setzte sie sich allgemein durch. Die veränderte Position des Priesters hatte aber erhebliche Auswirkungen auf das Liturgieverständnis. Denn nun dominierte der die Blicke auf sich ziehende Priester.
Die damit verbundene Versuchung, nämlich wie ein Moderator die Gemeinde durch die Feier zu führen, war und ist groß, dass viele Gemeinden heutzutage mit individuellen Arrangements konfrontiert sind, durch welche die Priester die Liturgie der Kirche kreativ umgestalten.
Dass nach einer Norm des Zweiten Vatikanischen Konzils niemand, und sei er auch Priester, irgendetwas auf eigene Faust in der Liturgie hinzufügen, wegnehmen oder ändern darf (SC 22), ist entweder unbekannt oder wird bewusst missachtet. Dies zeigen unter anderem die selbst gefertigten Orationen, Variationen der Hochgebete, Abweichungen von der Perikopenordnung, Übernahme der Einleitung und des Schlusses der Fürbitten durch Laien, gemeinsames Beten der Schlussdoxologie des Eucharistischen Hochgebetes, Auslassen des Embolismus, Brechen des eucharistischen Brotes durch Kommunionhelfer, gemeinsame Kommunion von Priestern und Gläubigen um nur die häufigsten Beispiele für Verstöße gegen die zitierte Konzilsnorm zu nennen. Natürlich kann man auch Priester finden, die in Treue gegenüber der Liturgie der Kirche zelebrieren.
Der mangelnde Respekt vor der liturgischen Ordnung ist freilich kein Einzelfall, sondern ein weit verbreitetes Phänomen. Es hängt nicht allein mit der herausgehobenen Position des Vorstehers zusammen, sondern mit den zum Teil radikalen Eingriffen bei der Liturgiereform. Denn diese mussten fast zwangsläufig den Eindruck erwecken, als ob man die Liturgie machen könne.
Und so meinte man, die Reform der Liturgie vor Ort nach eigenem Gutdünken konsequent zu Ende führen zu müssen. Das Resultat ist die fabrizierte Liturgie, mit der wir es nun seit vierzig Jahren zu tun haben, die auf Dauer die Einheit des römischen Ritus bedroht.
Das Messbuch Pauls VI. besiegelte nicht das Ende des usus antiquior der römischen Messe. Nach dem Konzil waren es zunächst vor allem Intellektuelle, Schriftsteller und Künstler, die sich öffentlich durch Petitionen für den Erhalt der tridentinischen Messe einsetzten (Yehudi Menuhin, Graham Greene, Agatha Christie, Jacques Maritain, später auch René Girard, Martin Mosebach, Robert Spaemann).
Bis zu Johannes Paul II. wurde die Feier der traditionellen Messform durch Indulte gewährt. Das bekannteste Beispiel ist das Indult für ganz England und Wales von 1971. Seit dem Motu Proprio Summorum pontificum (2007) Benedikts XVI. ist es allen Priestern, die rechtlich nicht an der Ausübung ihres Priesteramtes gehindert sind, wieder allgemein erlaubt, die Messe nach dem Missale von 1962 zu feiern.
Am Sonntag kann eine der Messen im usus antiquior gefeiert werden. Dies, wie in manchen Diözesen, nur alle vierzehn Tage zu erlauben, ist mit dem Motu proprio des Papstes nicht vereinbar. Eine Überprüfung der Umsetzung des Motu proprio steht in diesem Jahr an.
Dienst an der Einheit
In Summorum Pontificum erklärt Benedikt XVI., dass es sich bei der alten und der neuen Form der Messe nicht um zwei verschiedene Riten handelt, sondern um einen zweifachen usus des einen römischen Ritus gegen die These von zwei theologisch unvereinbaren Riten, die unisono, wenn auch in ganz unterschiedlicher Stoßrichtung, von der Piusbruderschaft, dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken und Wir sind Kirche, aber auch von zahlreichen Pfarrern vertreten wird.
Um die Einheit der beiden Formen der römischen Messe zu bewahren, bedarf es einer Reform der Reform. Dazu gehört zunächst einmal, dass ars celebrandi und liturgische Ordnung nicht mehr als Gegensatz betrachtet werden und man aufhört, die lateinische Liturgiesprache und die traditionelle Gebetsrichtung als vorkonziliar zu diffamieren.
Eine Reform der Reform wird auf Dauer aber auch moderate Korrekturen am Messbuch Pauls VI. beinhalten müssen. Zur Reform der Reform gehört auch der laufende Prozess zur Revision der deutschen Übersetzung des römischen Messbuchs. Bei aller nötigen Zielsprachenorientierung wird sich die neue Übersetzung gemäß der Übersetzerinstruktion Liturgiam authenticam (2001) präziser an den lateinischen Text halten und so die zahlreichen Paraphrasen und Nachdichtungen tilgen, die das 1975 in erster Auflage erschienene Messbuch für das deutschen Sprachgebiet enthält.
Vierzig Jahre nach dem Erscheinen des Missale Pauls VI. steht die katholische Kirche vor der immensen Aufgabe einer liturgischen Aussöhnung zwischen den Anhängern der alten und der neuen Form der Messe. Zu dem von Benedikt XVI. gewollten liturgischen Frieden wird es nur kommen, wenn es gelingt, Formlosigkeit und rituellen Verfall in der Feier der heiligen Messe zu überwinden, indem diese getreu der liturgischen Ordnung zelebriert wird.
Auf der anderen Seite darf die traditionelle Form der Messe nicht auf den Zustand von 1962 eingefroren werden. Dazu muss sie sich freilich ungehindert entfalten können. Wer sich aber für den Fortbestand der alten Liturgie einsetzt, wird wie ein Aussätziger behandelt: hier endet jede Toleranz (Joseph Ratzinger).
Doch mit dem Pontifikat Benedikts XVI. ist die katholische Kirche in eine neue Phase der Umsetzung der Liturgiereform eingetreten. Priester, Theologen und Bischöfe sind daher eingeladen, ihren Beitrag zu einer vertieften Rezeption des Konzils und zur liturgischen Versöhnung zu leisten.
© 2010 www.kath.net