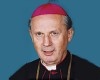
2. September 2010 in Spirituelles
Grazer Diözesanbischof Egon Kapellari Internationalen Sommerakademie in Aigen: Dieser reduziert Christus auf seine menschliche Natur, um so dem Vorverständnis vieler Zeitgenossen, darunter auch nicht weniger Christen, entgegenzukommen.
Linz-Aigen (kath.net)
Kath.Net dokumentiert die Predigt vom Grazer Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari beim Gottesdienst im Rahmen der Internationalen Sommerakademie des Linzer Priesterkreises am 31. August 2010 in Aigen i. Mühlkreis im Wortlaut:
Dem Wesen und Wirken des Heiligen Geistes ist die diesjährige Internationale Sommerakademie des Linzer Priesterkreises besonders zugewendet in Gebet, Liturgie und theologischer Betrachtung.
Entsprechend dem Liturgischen Kalender gedenken wir bei dieser abendlichen Eucharistiefeier eines vom Heiligen Geist besonders erfüllten Bischofs aus dem 4. Jahrhundert. Es ist der heilige Paulinus von Trier. In der deutschen Ausgabe des Messbuchs sagt die dort übliche Kurzbiographie des Tagesheiligen wörtlich: Der berühmteste Bischof von Trier im Altertum stand in den dogmatischen Auseinandersetzungen seiner Zeit unerschrocken auf der Seite des heiligen Athanasius und der Orthodoxie. Als einziger weigerte er sich auf der Synode zu Arles 353 jenen zu verurteilen, wurde daher vertrieben und starb in der Verbannung in Phrygien.
Der heilige Athanasius, Bischof von Alexandrien in Ägypten, war im Widerstand gegen die vom Konzil von Nikaia 325 verurteilte Irrlehre des Arius einer der stärksten und daher am meisten verfolgten Vertreter der Orthodoxie. Dreimal wurde er deshalb aus seiner Bischofsstadt vertrieben, einmal führte ihn die Verbannung bis in die Stadt Trier, die damals eine der Residenzstädte römischer Kaiser gewesen ist.
Die Irrlehre des Arius oder, positiv gewendet, die Lehre des Konzils von Nikaia über die Gottheit Jesu Christi ist heute nach fast siebzehn Jahrhunderten keineswegs nur ein Thema für Historiker. Es gibt in der heutigen Theologie christlicher Kirchen und in der spirituellen Praxis so etwas wie einen Neo-Arianismus, der Christus auf seine menschliche Natur reduziert, um so dem Vorverständnis vieler Zeitgenossen, darunter auch nicht weniger Christen, entgegenzukommen.
Mit der Preisgabe der Lehre des I. Ökumenischen Konzils über die Gottheit Christi und die daraus folgende Preisgabe der altkirchlichen Lehre über die göttliche Dreifaltigkeit wollen einige Theologen auch Barrieren gegenüber dem Islam und dem orthodoxen Judentum reduzieren.
Wenn aber die Differenz zwischen den Wörtern homo-ousios (= wesensgleich) und homoi-ousios (= wesensähnlich) zugunsten des homoi-ousios aufgegeben wird, wenn also Jesus Christus dem göttlichen Vater nur wesensähnlich und nicht wesensgleich ist, dann wird das Kühnste aufgegeben, das im Horizont der Religionsgeschichte über Gott als Schöpfer und Erlöser und über seine Beziehung zu seinen Geschöpfen je gesagt und geglaubt wurde.
Die Auseinandersetzungen mit Arius und mit dem Bekennermut des heiligen Athanasius von Alexandrien und des heiligen Bischofs Paulinus von Trier waren also nicht nur gestern aktuell, sondern sie sind es auch heute, wenn dies heute auch für viele Menschen in der Kirche nicht erkennbar ist.
Wenden wir uns aber nun dem Generalthema der diesjährigen Internationalen Sommerakademie zu. Es geht dabei um das Wesen des Heiligen Geistes und um sein Wirken in der Kirche und durch die Kirche in jene Wirklichkeit hinein, die im Johannesevangelium Welt und in heutiger weltlicher Umgangssprache Gesellschaft genannt wird. Diese Welt oder Gesellschaft trägt seit dem Verlust des Paradieses jederzeit viele Todeskeime aber auch viele Lebens- und Hoffnungskeime in sich.
Das Protoevangelium im Genesisbuch des Alten Testaments verweist, gelesen mit den Augen des christlichen Glaubens, auf die künftige Erlösung und das Evangelium des Neuen Testaments verkündet, dass diese Erlösung in Jesus Christus geschehen ist.
Aber dieses grundsätzlich ein für allemal geschehene Heilswerk durchdringt die Welt und ihre Geschichte nur wie ein geduldiger Sauerteig und die Kirche ist das Werkzeug für dieses Geschehen im Ringen zwischen dem göttlichen Licht und der Finsternis des Bösen.
Die Gesellschaft, in deren Mitte die Kirche in Ländern wie dem unseren heute lebt, ist technisch-zivilisatorisch weiterhin durch unablässig fortgesetzte Innovationen geprägt. Bezogen auf das Humanum im Ganzen trägt sie aber unübersehbare Merkmale einer Spätzeit an sich. Viel humanitär lange tragend Gewesenes ist von Auszehrung bedroht.
Die Katholische Kirche ist von diesem Epochenwechsel auf besonders schwerwiegende Weise betroffen. Sie ist die weltweit größte einheitlich verfasste Religionsgemeinschaft und sie ist dadurch, was ihre Einheit betrifft, den größten Herausforderungen ausgesetzt. Sie steht in der Spannung zwischen Homogenität und Pluralität, zwischen Breite und Tiefe, zwischen Tradition und neuen Herausforderungen, zwischen sozial-politischem Engagement und mystischer Versenkung in Gott.
Sie macht Fehler und begeht Sünden, hat aber zugleich riesige Ressourcen an Mitmenschlichkeit, an Barmherzigkeit und Heiligkeit und aktiviert viel davon an jedem neuen Tag. Das gilt auch für die Kirche in unserem kleinen Land Österreich: für ihre Wunden ebenso, wie für die Gaben des Heiligen Geistes, die in ihr oft abseits des öffentlichen Interesses, aber immer wieder auch offenkundig am Werk sind.
Hierzulande ist die Kirche immer noch einem riesigen Baum mit breiter Krone vergleichbar. Aber viele seiner Wurzeln, Äste und Zweige sind in ihrer Vitalität bedroht oder auch schon abgestorben. Ernsthafte Christen werden sich in dieser Situation nicht vor allem um die Baumkrone sorgen. Sie werden sich vielmehr für eine Stärkung der Wurzeln und für eine Vermehrung des Grundwassers einsetzen.
Schrumpfungen sind aber epochal offenbar nicht verhinderbar. Auf jeden Getauften, der die Kirche verlässt, hat Jesus Christus in der Taufe bildhaft gesprochen seine Hand gelegt und er zieht sie nicht zurück, wenn ein Mensch sich aus diesem bergenden Schutz entfernt. Darum sind auch die aus der Kirche Ausgetretenen dem stellvertretenden Gebet der treu in der Kirche Bleibenden besonders anvertraut.
Kirche ist ja wesentlich auch Stellvertretung vor Gott für die Menschen und für die Menschheit draußen vor ihrer Tür. Diese fundamentale Wahrheit wird uns aus aktuellem und mehr noch künftigem Anlass noch bewusster werden müssen.
Papst Benedikt XVI. hat dazu schon vor Jahrzehnten als Professor voraussehend in einem Aufsatz zum Thema Stellvertretung überaus prägnant Wichtiges gesagt.
Liebe hier versammelte Christen, Brüder und Schwestern und in Ihrer Mitte, liebe Priester und Diakone!
Von Kardinal Newman, den der Papst in einigen Wochen in Birmingham feierlich in das Verzeichnis der Seligen aufnehmen wird, stammt ein bekannter epochenkritischer Text.
Er beginnt mit den Worten: Die Zeit ist voller Bedrängnis, die Sache Christi liegt wie im Todeskampf. Dem setzt Newman aber ein tief gläubiges Und doch, ein Trotzdem entgegen und er setzt so die Reihe biblischer Texte fort, in denen dies ebenso geschieht.
Ich zitiere in Auswahl den für Martin Buber besonders wichtig gewesenen Psalm 73. Dort sagt der Psalmist nach Hinweisen auf viele Bedrängnisse zu Gott: Und doch bleibe ich stets bei dir; meine rechte Hand hast du ergriffen. Nach deinem Ratschluss führst du mich und nimmst mich hernach in Ehren auf.
Und als zweites biblisches Beispiel für ein gläubiges Trotzdem in schwerer Zeit nenne ich das sogenannte Canticum Habakuk, dem wir im Stundengebet am Freitag der zweiten Woche begegnen. Da heißt es (Hab 3,17-18): Zwar blüht der Feigenbaum nicht, an den Reben ist nichts zu ernten, der Ölbaum bringt keinen Ertrag, die Kornfelder tragen keine Frucht; im Pferch sind keine Schafe, im Stall steht kein Rind mehr. Dennoch will ich jubeln über den Herrn und auch freuen über Gott, meinen Retter.
Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie die Füße der Hirsche und lässt mich schreiten auf den Höhen. Soweit die beiden Texte aus dem Alten Testament. Sie sind Worte auch für uns in einer Zeit vieler Umbrüche, Abbrüche, aber auch Aufbrüche in Kirche und Gesellschaft. Der Heilige Geist möge uns die Kraft geben, diese Worte immer wieder in gläubigem Vertrauen nachzusprechen.
© 2010 www.kath.net