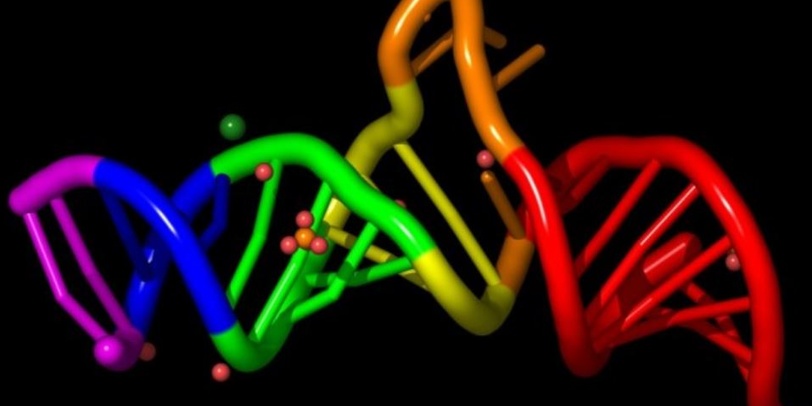
7. Jänner 2014 in Kommentar
Mit der Abschaffung des Wissenschaftsministeriums, dessen Aufgaben nunmehr das Wirtschaftsministerium erfüllen soll, erreicht ein Trend seinen vorläufigen Höhepunkt. Ein Gastbeitrag von Daniel Saudek
Innsbruck (kath.net) Welchen Stellenwert hat Wissenschaft in unserer Gesellschaft? Entscheidungen und Stellungnahmen der neuen österreichischen Regierung bieten Anlass zu einer grundsätzlichen Reflexion. Da ist vor allem die Abschaffung des Wissenschaftsministeriums, dessen Aufgaben nunmehr das Wirtschaftsministerium erfüllen soll. Damit erreicht ein langjähriger Trend, Wissenschaft als Teil der Wirtschaft zu begreifen, seinen vorläufigen Höhepunkt. Ich denke aber auch an eine Wortmeldung der neuen Familienministerin zum Thema der Definition des Begriffes der Familie: dies sei eine philosophische Frage, und daher sei Familie einfach dort, wo sich Menschen zu Hause fühlen. Bemerkenswert ist hier, dass der Begriff philosophisch für das steht, was bloßer subjektiver Beliebigkeit anheimgestellt ist, und worauf es keine richtigen Antworten gibt.
Was aber kann und soll Wissenschaft und dazu gehört auch die Philosophie leisten? Der wörtlichen Bedeutung dieses Begriffes zufolge geht es um Wissen, also nach Platon um wahre, begründete Meinung. Die Aufgabe der Wissenschaft ist demnach, soweit dies möglich ist, herauszufinden, was wirklich der Fall ist und was nicht. Da sich aber vieles unserem Wissen entzieht, wird diese Aufgabe auch beinhalten, die Grenzen unseres Wissens aufzuzeigen, also zu beurteilen, was bloß wahrscheinlich, unsicher oder vielleicht sogar prinzipiell nicht beweisbar ist.
Nun wird aber ein solcher Wissenschaftsbegriff vielerorts als veraltet betrachtet. Auch innerhalb der wissenschaftlichen Szene selbst gilt es häufig als naive Vorstellung, Wissenschaft könne zu sicherem Wissen über objektiv existierende Sachverhalte führen ein Ideal, das seit der Aufklärung nun wirklich nicht mehr tragbar sei, und von dem man sich selbstverständlich verabschiedet habe. Schon Paul VI. beklagte, dass man allzu oft von Wissenschaftlern hörte: Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht, wir können es nicht wissen. Es verwundert nicht, dass die Wissenschaft folglich dem gesellschaftlichen Druck, sich einer ihr fremden Sachlogik unterzuordnen, wenig entgegensetzen kann. Wenn es wahr und falsch ohnehin so nicht gibt, warum sollte man diese Kategorien dann nicht durch profitabel und unprofitabel ersetzen? Dass paradoxerweise gerade die als wissenschaftsfeindlich verschriene Kirche zum Vertrauen auf die Erkenntnisfähigkeit des Menschen aufruft (wie etwa in der Enzyklika Fides et Ratio Johannes Pauls II.), erscheint wie ein dumpfes Echo aus fernen Zeiten, von Menschen kommend, die immer noch dem Denken der Scholastik verhaftet seien.
Woher stammt aber die in unserer Kultur so weit verbreitete Skepsis gegenüber der Möglichkeit sicheren Wissens, und damit auch gegenüber der Wissenschaft? Das ist eine komplizierte Geschichte. Sicher hat es jedoch mit dem wiederholten Umsturz unserer Weltbilder in den vergangenen Jahrhunderten zu tun. Das aristotelisch-ptolemäisch geprägte Weltbild wurde durch das mechanistische der Neuzeit ersetzt, welches wiederum durch die Erkenntnisse der modernen Physik umgestürzt wurde und auch heute ist kein Ende dieser ständigen Umbrüche in Sicht. Wer weiß also, ob nicht auch wir heute völlig daneben liegen? So weit, so richtig. Daraus folgt aber nicht, dass kein sicheres Wissen möglich wäre. Für ein solches braucht es nicht notwendigerweise eine Theorie von allem, eine umfassende Erklärung der gesamten Welt es gibt sogar Gründe anzunehmen, dass so etwas prinzipiell nicht möglich ist. Im Gegenteil konnte man gerade in den letzten Jahrhunderten eine Menge von Sachverhalten beweisen, die vorher unbekannt waren. Ich denke z.B. an Tatsachen über die Vergangenheit der Erde und des Kosmos, aber auch an die Zusammensetzung chemischer Stoffe aus Elementen. Es mag schon sein, dass sich unser Weltbild noch einmal grundsätzlich ändern wird. Dies wird aber kaum dazu führen, dass man derartige Fakten über Bord werfen und z.B. eingestehen wird müssen, dass Dinosaurier nun doch nicht existiert hätten; dass die DNA doch nicht in Form einer Doppelhelix angeordnet wäre; oder dass die Verwandtschaft unter den indoeuropäischen Sprachen eine bloße Fiktion wäre. Wir können sehr wohl manches wissen, ohne alles zu wissen ein Umstand, der in der Wissenschaftstheorie, wie auch in einem in unserer Kultur verbreiteten Skeptizismus, gerne übersehen wird.
Die Krise der Vernunft, in der wir leben, hängt aber auch eng mit der Krise des Glaubens zusammen: wenn es keine sicheren Grundlagen gibt, dann bleibt nur mehr der Fideismus, also der Sprung ins Ungewisse. Wenn weit und breit kein fester Fels in Sicht ist, muss man eben auf den Sand einer bloß subjektiven Entscheidung bauen. Der Glaube in seiner fideistischen Gestalt wird leicht unsicher, kraftlos, und vermag nicht zu tragen. Oder aber er wird autoritär, setzt auf den gesellschaftlichen Konsens oder überkommene Tradition, und vergisst, dass sich die Wahrheit kraft der Wahrheit durchsetzt, nicht kraft gesellschaftlichen Drucks. Ironischerweise nimmt die letztere Version des Fideismus die Selbstrelativierung der Wissenschaft dankbar an. Unliebsame Ergebnisse der Wissenschaften können dann leicht mit dem Hinweis abgeschmettert werden, sie seien eben nur Theorie, und alle Theorien würden sich irgendwann sowieso als falsch erweisen.
Daher würde ich behaupten: gute Wissenschaft bringt allen was - gehts der Wissenschaft gut, gehts uns allen gut. Wir brauchen realistische Einschätzungen und wahre Überzeugungen, um den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu begegnen. Wir brauchen Natur und Vernunft um zu erkennen, was ethisch geboten ist. Indem die Wissenschaft die Möglichkeiten und die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit bemerkbar macht, ermöglicht sie eine realistische Einschätzung der Stellung des Menschen im Universum, und letztlich auch vor Gott, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind (Kol. 2,3). Die Wissenschaft ist eine Form der Anteilhabe an diesen verborgenen Schätzen, denn Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verhüllen, des Königs Ehre ist es, eine Sache zu erforschen (Sprw. 25,2).
Der Dienst der Wissenschaft an der Gesellschaft besteht darin, so gut es möglich ist, Wissen zu gewinnen. Dazu muss sie nach den Kriterien der Wahrheit arbeiten können, die folglich nicht der Logik der Profitmaximierung unterworfen werden dürfen. Der verbreitete Utilitarismus und Relativismus in Bezug auf Wissenschaft, den auch die beiden Regierungsparteien deutlich an den Tag legen, hilft dieser nicht, ihre Aufgabe zu erfüllen.
Mag. Daniel Saudek ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für christliche Philosophie der Universität Innsbruck
© 2014 www.kath.net