 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:   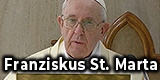  Top-15meist-diskutiert
| 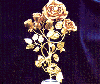 'Goldene Rose' für Altötting9. April 2008 in Deutschland, keine Lesermeinung Papst Benedikt XVI. zeichnet Altöttinger Marienheiligtum besonders aus. Kardinal Meisner überbringt am 15. August als Kardinallegat die "Goldene Rose" Rom/Passau/Altötting (kath.net/iop) Mit der Goldenen Rose wird zum ersten Mal ein deutsches Marienheiligtum besonders geehrt. Papst Johannes Paul II. hatte die Auszeichnung bereits an die Marienheiligtümer Tschenstochau, Loreto, Knock in Irland und an Lourdes verliehen. Papst Benedikt XVI. vergab sie bisher an Mariazell in Österreich und an Aparecida in Brasilien. Wie weltweit kein anderer Wallfahrtsort wird Altötting, auch Herz Bayerns genannt, von Papst Benedikt XVI. persönlich ausgezeichnet. Denn bereits bei seinem Besuch in Altötting, im September 2006, hatte er den Bischofsring, den er bis zu seiner Papstwahl trug, vor dem Altöttinger Gnadenbild niedergelegt. Heute ist dieser Ring am Zepter der Muttergottes-Statue angebracht. Die Goldene Rose verlieh der Papst einst in der Fastenzeit Die Goldene Rose ist eine aus Gold gefertigte Blüte. Das Brauchtum geht zurück auf eine mittelalterliche Prozession am 4. Fastensonntag, Laetare genannt, in Rom. An diesem Sonntag in der Mitte der Fastenzeit damit war der Höhepunkt des Fastens überschritten und der Blick richtete sich hoffnungsvoll auf das Osterfest trug der Papst zunächst eine natürliche, später eine goldene Rose zur Kirche Santa Croce. Der Papst hielt die Rose in der linken Hand und segnete mit der rechten die Menschen. Die Rose überreichte er am Ende dem Stadtpräfekten Roms. So entstand auch der Name Rosensonntag. Unter Papst Leo IX. (1002-1054) ist der Brauch im Jahr 1049 zum ersten Mal erwähnt. Er hat sich bis ins 19. Jahrhundert gehalten, auch über Rom hinaus. Es dürfte sich zu Anfang um eine Kreuzverehrung gehandelt haben, die später mit Blumen als Frühjahrssymbolen erweitert wurde. Die Rose symbolisiert ChristusDie Rose steht für Christus in einem doppelten Sinn. Das Gold steht für Auferstehung, die Dornen für die Passion. Die Rose diente dazu, an Laetare (lat. freuen) den Ruhm der Auferstehung Christi zu zeigen, um damit die Trauer über das Leiden Christi zu mildern. So hat zum Beispiel Papst Alexander III. (1159-1181) dazu geschrieben: das Gold bezeichne Christus, die rötliche Färbung des Edelmetalls stehe für das Leiden, der Duft verkünde die Herrlichkeit der Auferstehung. Zeichen des päpstlichen Wohlwollens ist auch VerpflichtungPapst Urban II. war der erste, der diese Rose im Jahr 1096 an eine Person verlieh, die sich um die katholische Kirche sehr verdient gemacht hat. Jährlich wurde die Rose durch einen Goldschmied, im Auftrag des Papstes, angefertigt. Im Lauf der Jahrhunderte wurde dieses Zeichen des päpstlichen Wohlwollens und gleichzeitig auch der Diplomatie nicht nur Persönlichkeiten verliehen, darunter etwa der Bayernherzog Albrecht II. für die Stiftung von Kloster Andechs, sondern auch Institutionen oder Städte wie Venedig oder Florenz. Die Goldene Rose sollte die Empfänger aber nicht nur ehren, sondern sie immer auch an die religiöse Verpflichtung erinnern. Die letzten Päpste haben nur noch Wallfahrtsorte besonders ausgezeichnet Im Lauf der Zeit zeichneten die Päpste verdiente Männer mit Schwert und Hut aus. Die letzte Rose erhielt 1780 Großherzog Johann Karl von Österreich. Bei den Frauen war auch Kaiserin Elisabeth unter den Geehrten. Als einzige Bürgerliche erhielt die Amerikanerin Mary Gwendoline Caldwell, Mäzenin der Catholic University of America in Washington, von Papst Leo XIII. (1878-1903) die Auszeichnung. Großherzogin Charlotte von Luxemburg war 1956 die letzte Frau, die das päpstliche Ehrenzeichen bekam. Danach wurde die Goldene Rose nur mehr bedeutenden Gotteshäusern, überwiegend Heiligtümern der Mutter Gottes zugedacht. Pius XII. sandte sie nach Goa in Indien, Paul VI. nach Guadalupe in Mexiko und Fatima in Portugal. Unter Papst Johannes Paul II., der sein Pontifikat unter den besonderen Schutz der Gottesmutter gestellt hatte, kamen weitere Wallfahrtsorte dazu. Benedikt XVI. führt diese Tradition fort. Das päpstliche Breve überbringt der Legat des Papstes Ursprünglich übergab der Papst die Rose selbst, später dann, wenn die zu Ehrenden nicht in der Ewigen Stadt anwesend waren, übernahm dies eine Gesandtschaft mit einem päpstlichen Legaten. Dieser überbrachte das sogenannt päpstliche Breve. Der Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meisner, wird dies im Auftrag von Papst Benedikt XVI. als Kardinallegat beim feierlichen Pontifikalamt am 15. August tun. Der Bischofsring des Papstes für die Mutter Gottes Wie wichtig ihm das Altöttinger Marienheiligtum ist, hat Papst Benedikt XVI. im September 2006 unterstrichen. Am Ende der Vesper in der Basilika legte er den Bischofsring, den ihm sein Bruder Georg und seine Schwester Maria zur Bischofsweihe am 28. Mai 1977 geschenkt haben und den er als Erzbischof und Kardinal bis zur Papstwahl getragen hat, vor dem Gnadenbild der Mutter Gottes nieder. Der goldene Ring heute am Zepter des Gnadenbildes befestigt - umschließt einen großen Amethyst, in den eine Taube mit einem Ölzweig eingraviert ist. Die Darstellung erinnert an die Taube, der Noah am Ende der Sinnflut einen Ölzweig brachte und damit den göttlichen Frieden und den Bund Gottes mit den Menschen ankündigte. Die Wallfahrt zum Gnadenbild Die im Bistum Passau gelegene Wallfahrtsstadt Altötting ist das beliebteste Ziel der deutschen Pilger. Elf Millionen Deutsche kennen die Stadt. Allein 1,7 Millionen Deutsche haben das Herz Bayerns bereits im Rahmen einer Pilgerreise besucht. Über eine Million Pilger kommen jedes Jahr aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Ihr Ziel ist die Schwarze Madonna, das gotische Gnadenbild in der Gnadenkapelle. Es dürfte aus Burgund stammen. Die 65 Zentimeter hohe, gefasste Figur der Madonna mit Kind ist aus Lindeholz geschnitzt. Durch Kerzenrauch geschwärzt, ist sie als Schwarze Madonna bekannt geworden. Die Bekleidung ist barock und reich verziert. Das Haupt der Madonnenfigur und des Jesuskindes sind bekrönt. Doch letztlich ist das Bild bekleidet und bekrönt durch das Vertrauen, den Glauben der Pilger, die seit über 500 Jahren in allen Nöten und Freuden des Lebens zur Mutter Gottes nach Altötting kommen. So ist ein Bild, das die Menschen im Namen Christi versammelt, in der Tat ein Gnadenbild. Die Wunder in den Jahren 1489 und 1490 Die Wallfahrt geht zurück auf zwei Wunder, in den Jahren 1489 und 1490 geschehen. Ein dreijähriger Knabe ertrinkt, ein weiterer wird von einem Wagen überfahren. Die Eltern beider Kinder rufen die Mutter Gottes an, und die schenkt den beiden Knaben das Leben zurück. Der Ort ist aber älter. König Karlmann, der Urenkel Karls des Großen, machte Altötting um 865 zur Hauptresidenz. Wo sich heute der Kapellplatz befindet, stand ein Herzoghof. In der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts wurde das Oktogon der heutigen Kapelle gebaut. Im Inneren birgt die Gnadenkapelle in silbernen Urnen die Herzen der bayerischen Könige und Kurfürsten. Aufgrund der besonderen Verbundenheit von Volk und Landesherren mit der Wallfahrt zu Unserer Lieben Frau von Altötting hat das Heiligtum den Beinamen Herz Bayerns erhalten. Altötting ein pulsierendes Pilgerzentrum Altötting ist mit den internationalen Kontakten und einem jährlich im August stattfindenden Internationalen Jugendforum ein pulsierendes Pilgerzentrum. Von Mai bis Oktober finden große Wallfahrten, festliche Gottesdienste und jeweils am Samstagabend Lichterprozessionen statt. Der Festtag Mariä Himmelfahrt gilt als der große Pilgertag. Mit Papst Benedikt XVI. kam nach 1782 mit Papst Pius VI. und 1980 mit Johannes Paul II. - zum dritten Mal der Nachfolger des heiligen Petrus in den Marienwallfahrtsort Altötting und in die Diözese Passau. Neue Impulse durch die Neue Schatzkammer Im Mai 2009 soll die Neue Schatzkammer und das künftige Wallfahrtsmuseum eröffnet werden. Dort sollen das weltbekannte Goldene Rössl und die vielen Pretiosen der Wallfahrt endgültig seinen Platz finden. Bischof Wilhelm Schraml geht es um grundsätzliche Impulse für die Stadt Altötting und die Wallfahrt. Wir zeigen die Schätze, aber dahinter, so der Bischof, den tiefen Glauben und das Vertrauen, aus denen sie entstanden sind. Zum Bestand der Schatzkammer und des künftigen Museums zählen neben liturgischen Gewändern und Geräten unter anderem rund 1300 Rosenkränze, 1200 Schmuckstücke, 1600 Münzen, Medaillen und Wallfahrtsabzeichen, wie eine aktuelle Inventarisierung ergab. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuWallfahrten
|       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
