 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Spe gaudentes, froh in der Hoffnung23. Dezember 2007 in Spirituelles, keine Lesermeinung "Ohne die Tugend des Heiligen Geistes gibt es keine Fülle der Hoffnung". Dritte Adventspredigt von P. Raniero Cantalamessa im Vatikan. Rom (www.kath.net/Zenit) Der Gott der Hoffnung möge uns an diesem Weihnachtsfest durch den Heiligen Geist und auf die Fürsprache Mariens, der Mutter der Hoffnung, gewähren, fröhlich zu sein in der Hoffnung und sie in Fülle zu haben. * * * 1. Jesus der Sohn Wir lassen die Propheten und Johannes den Täufer beiseite und konzentrieren uns in dieser dritten und letzten Meditation ausschließlich auf den Zielpunkt von allem: den Sohn. Unter diesem Gesichtspunkt bezieht sich der Text aus dem Hebräerbrief direkt auf das Gleichnis von den bösen Winzern. Auch dort entsendet Gott zuerst Diener, zum Schluss aber dann den Sohn und sagt: Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben (Mt 21,33-41). In einem Kapitel seines Buches über Jesus von Nazareth erläutert der Papst den grundlegenden Unterschied zwischen dem Titel Sohn Gottes und dem des Sohnes. Der einfache Titel Sohn ist im Gegenteil zu dem, was man denken könnte, bedeutend prägnanter als der Titel Sohn Gottes. Letzterer wird Jesus nach einer langen Reihe von Beinamen zugewiesen; so war das Volk Israel und vereinzelt dessen König bezeichnet worden; so ließen sich auch die Pharaonen und die orientalischen Herrscher nennen; und als solcher wird sich der römische Kaiser ausrufen. Für sich genommen wäre dieser Titel deshalb nicht ausreichend gewesen, um die Person Christi von jedem anderen Sohn Gottes zu unterscheiden. Anders gelagert ist der Fall mit dem einfachen Titel Sohn. Dieser taucht in den Evangelien als ausschließlich Christus zugehöriger Titel auf, und mit ihm wird Jesus seine tiefe Identität zum Ausdruck bringen. Nach den Evangelien ist es gerade der Hebräerbrief, der diesen absoluten Gebrauch des Titels der Sohn besonders bezeugt; er kommt fünf Mal vor. Der bedeutsamste Text, in dem sich Jesus selbst als der Sohn definiert, ist Matthäus 11,17: Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Dieser Ausspruch, so erklären die Exegeten, ist deutlichen aramäischen Ursprungs und zeigt, dass die späteren Entwicklungen, die dazu im Johannesevangelium zu lesen sind, ihren Ursprung im Bewusstsein Christi selbst haben. Eine derartig totale und absolute Gemeinschaft der Erkenntnis zwischen Vater und Sohn, merkt der Papst in seinem Buch an, erklärt sich nicht ohne eine ontologische Gemeinschaft. Die späteren Formulierungen, die ihren Höhepunkt in der Definition von Nizäa finden, vom Sohn als gezeugtem, nicht geschaffenem, eines Wesens mit dem Vater, sind also gewagte, aber mit dem Evangelium kohärente Weiterentwicklungen. Der stärkste Beweis für das Bewusstsein, das Jesus von seiner Identität als Sohn hatte, ist sein Gebet. In ihm wird die Sohnschaft nicht nur erklärt, sondern gelebt. Hinsichtlich der Weise und Häufigkeit, mit denen der Ausruf Abba im Gebet Christi vorkommt, bezeugt eine Intimität und Vertrautheit mit Gott, die in der Tradition Israels mit nichts verglichen werden kann. Wenn der Ausdruck in der ursprünglichen Sprache bewahrt worden ist und das Kennzeichen des christlichen Gebets wird (vgl. Gal 4,6; Röm 8, 15), so ist dies so, gerade weil man überzeugt war, dass dies die typische Form des Gebetes Jesu war. (Vgl. J. Dunn, op. cit., S. 746 ff.) 2. Ein Jesus der Atheisten? Dieses dem Evangelium entnommene Ergebnis wirft ein einzigartiges Licht auf die aktuelle Debatte um die Person Jesu. In der Einleitung seines Buches zitiert der Papst die Aussage von R. Schnackenburg: Ohne Verankerung in Gott bleibt die Person Jesu schemenhaft, unwirklich und unerklärlich. Das, so erklärt der Papst, ist auch der Konstruktionspunkt dieses meines Buches: Es sieht Jesus von seiner Gemeinschaft mit dem Vater her, die die eigentliche Mitte seiner Persönlichkeit ist, ohne die man nichts verstehen kann und von der her er uns auch heute gegenwärtig wird. (Benedikt XVI, Jesus von Nazareth, Herder 2007, S.12). Dies stellt meines Erachtens die Problematik einer historischen Forschung über Jesus dar, die nicht nur vom Glauben absieht, sondern ihn von vornherein ausschließt; mit anderen Worten: die historische Plausibilität dessen, was manchmal als der Jesus der Atheisten bezeichnet wurde. Ich spreche jetzt nicht vom Glauben an Christus und seine Göttlichkeit, sondern vom Glauben im ganz allgemeinen Sinn des Wortes, vom Glauben an die Existenz Gottes. Die Vorstellung, dass Nichtgläubige kein Recht hätten, sich mit Jesus zu beschäftigen, liegt mir fern. Was ich im Ausgang der zitierten Worte des Papstes hervorheben will, sind die Folgen, die sich aus einem derartigen Ausgangspunkt ergeben, das heißt: wie das Vorverständnis dessen, der nicht glaubt, bedeutend mehr Einfluss auf die historische Forschung nimmt als das des Glaubenden - das Gegenteil von dem, was die nichtgläubigen Gelehrten denken. Leugnet man den Glauben an Gott oder sieht man von ihm ab, so wird nicht nur die Gottheit eliminiert oder der so genannte Christus des Glaubens, sondern auch der historische Jesus tout court, ja es bleibt nicht einmal der Mensch Jesus übrig. Keiner kann historisch bestreiten, dass der Jesus der Evangelien in ständigem Bezug zum himmlischen Vater lebt und wirkt, dass er betet und zu beten lehrt, dass er alles auf dem Glauben an Gott gründet. Wird diese Dimension vom Jesus der Evangelien ausgeschlossen, so bleibt absolut nichts von ihm übrig. Wenn man also stillschweigend oder erklärtermaßen von der Voraussetzung ausgeht, dass Gott nicht existiert, so ist Jesus nichts anderes als einer jener vielen Getäuschten, die gebetet, angebetet und mit dem eigenen Schatten gesprochen haben, oder mit der Projektion des eigenen Wesens, um es mit Feuerbach zu sagen. Jesus wäre das berühmteste Opfer dessen, was der militante Atheist Dawkins die Illusion Gott nennt. (R. Dawkins, God Delusion, Bantam Books, 2006) Wie aber ist es dann zu erklären, dass das Leben dieses Menschen die Welt verändert hat, und dass es im Abstand von 2000 Jahren weiterhin die Geister anregt wie kein anderes? Wenn die Illusion dazu fähig ist, das zu wirken, was Jesus in der Geschichte gewirkt hat, so müssen vielleicht Dawkins und die anderen ihren Begriff der Illusion neu fassen. Es gibt nur einen Ausweg aus dieser Schwierigkeit; jenen, der im Bereich des Jesus Seminar von Berkeley in den Vereinigten Staaten entwickelt worden ist: Jesus war kein gläubiger Jude; er war im Grunde ein Wanderphilosoph, im Stil der Kyniker. (Zur Theorie des Kynikers Jesus: vgl. . B. Griffin, Was Jesus a Philosophical Cynic?) Er hat weder das Reich Gottes gepredigt noch ein bevorstehendes Ende der Welt. Er hat nur Weisheitsmaximen im Stil eines Zen-Meisters ausgesprochen. Sein Ziel war es, in den Menschen das Bewusstsein von sich selbst zu erwecken, sie zu überzeugen, dass sie weder ihn noch einen anderen Gott brauchten, da sie in sich selbst einen göttlichen Funken tragen. (Vgl. di Harold Bloom, Whoever discovers the interpretation of these sayings ,in: The Gospel of Thomas. The Hidden Sayings of Jesus, Harper Collins Publishers, San Francisco 1992) Es sind dies alles welch ein Zufall! allerdings die Thesen, die seit Jahrzehnten das New Age predigt! Das soundsovielte Bild von Jesus als Produkt der jeweiligen Mode des Augenblicks. Es ist wahr: Ohne Verankerung in Gott bleibt die Person Jesu schemenhaft, unwirklich und unerklärlich. 3. Die Präexistenz Christi und die Dreifaltigkeit Auch hier, wie bei der Reduktion Jesu auf einen Propheten, stellt sich das Problem nicht nur in der Diskussion mit der nichtgläubigen Kritik; es stellt sich in verschiedener Art und mit verschiedener Absicht auch in der theologischen Diskussion der Kirche. Ich versuche zu erklären, in welchem Sinn. Was den Titel des Gottessohnes betrifft, so stehen wir im Neuen Testament vor einen Art Aufstieg auf den Berg: Am Anfang wird er mit der Auferstehung Christi in Beziehung gesetzt (Röm 1,4; Apg); Markus geht einen Schritt zurück und setzt ihn in Bezug zur Taufe am Jordan (Mk 1,11); Matthäus und Lukas lassen ihn auf die Geburt aus Maria zurückgehen (Lk 1,35). Der Hebräerbrief macht den entscheidenden Sprung, indem er sagt, dass der Sohn nicht zu existieren begonnen hat, als er zu uns gekommen ist, sondern dass er von jeher existiert. Durch ihn, sagt er, hat Gott die Welt erschaffen, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Ungefähr dreißig Jahre später wird das Evangelium des Johannes diese Errungenschaft anerkennen, indem er es mit den Worten beginnt: Am Anfang war das Wort . Nun, zur Präexistenz Christi als ewiger Sohn des Vaters wurden im Bereich einiger so genannter neuer Christologien sehr problematische Thesen vorgebracht. In ihnen wird behauptet, das die Präexistenz Christi als ewiger Sohn des Vaters ein mythischer Begriff sei, der aus dem Hellenismus stammt. Mit modernen Worten würde dies einfach bedeuten, dass die Beziehung zwischen Gott und Jesus sich nicht nur in einem zweiten Moment und sozusagen zufällig entwickelt hat, sondern a priori besteht und in Gott selbst gründet. Mit anderen Worten: Jesus präexistierte in einem intentionalen, nicht realen Sinn; in dem Sinn also, dass der Vater von jeher den Jesus als Sohn vorgesehen, gewählt und geliebt hat, der eines Tages aus Maria geboren werden sollte. Er präexistierte also auf nicht andere Weise wie wir alle, da jeder Mensch, so sagt die Schrift, von Gott als sein Kinde vor der Schöpfung der Welt erwählt und bestimmt worden ist (vgl. Eph 1,4). Zusammen mit der Präexistenz Christi fällt in dieser Optik auch der Glaube an die Dreifaltigkeit. Diese wird auf etwas heterogenes reduziert (eine ewige Person, der Vater, plus eine historische Person, Jesus, plus eine göttliche Energie, der Heilige Geist); etwas, das darüber hinaus nicht ab aeterno existiert, sondern in der Zeit wird. Ich beschränke mich darauf, anzumerken, dass auch diese These nicht neu ist. Die Idee einer rein intentionalen und nicht realen Präexistenz des Sohnes wurde von alten christlichen Denkern vorgebracht, diskutiert und verworfen. Es ist deshalb nicht wahr, dass sie von den neuen, nicht mehr mythischen Konzeptionen zwingend gemacht wird, die wir von Gott haben, ebenso wenig wie es wahr ist, dass die gegenteilige Idee einer ewigen Präexistenz die einzig denkbare Lösung im antiken kulturellen Kontext war und dass die Väter somit keine andere Wahl hatten. Photinus kannte schon im 4. Jahrhundert die Idee einer Präexistenz Jesu entsprechend der Vorausschau (kata prognosin) oder entsprechend der Vorwegnahme (procherestikes). Gegen ihn beschloss eine Synode: Wenn einer sagt, dass der Sohn vor Maria nur entsprechend der Vorausschau existierte und nicht vom Vater in Ewigkeit gezeugt wurde, um Gott zu sein und durch ihn alle Dinge ins Sein kommen zu lassen, so sei dieser mit dem Bann belegt. (Formel der Synode von Sirmium, 351, in A. Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln in der alten Kirche, Hildesheim 1962, S.197) Die Absicht dieser Theologen war lobenswert: in eine Sprache, die dem Menschen von heute verständlich ist, die alte Gegebenheit zu übersetzen. Leider aber ist wieder einmal das, was in moderne Sprache übersetzt wird, nicht das, was die Konzilien definiert haben, sondern das, was von den Konzilien verurteilt wurde. Schon der hl. Athanasius merkte an, dass die Idee einer Dreifaltigkeit, die sich aus heterogenen Wirklichkeiten zusammensetzt, gerade jene göttliche Einheit kompromittiert, die damit gesichert werden sollte. Wenn dann zugegeben wird, dass Gott in der Zeit wird, so kann keiner versichern, dass sein Wachstum und sein Werden beendet sind. Wer geworden ist, wird weiterhin werden. (Vgl. S. Athanasius, Gegen die Arianer, I, 17-18 (PG 26, 48) Wie viel Zeit und Mühe würde uns doch eine weniger oberflächliche Erkenntnis ersparen! Ich möchte diesen Lehrabschnitt unserer Betrachtung mit einer positiven Anmerkung beenden, die meines Erachtens von außerordentlicher Bedeutung ist. Für fast ein Jahrhundert, seit Wilhelm Bousset im Jahr 1913 sein berühmtes Buch über Christus-Kyrios (Wilhelm Bousset, Kyrios Christos, 1913) geschrieben hat, war im Bereich der kritischen Studien die Idee vorherrschend, dass der Ursprung des Kultes Christi als des göttlichen Wesens im hellenistischen Kontext und somit weit nach dem Tod Christi zu suchen sei. Im Bereich der so genannten dritten Forschung über den historischen Jesus wurde die Frage vor kurzem wieder von Grund auf von Larry Hurtado aufgenommen, Professor für Sprachen, Literatur und Theologie des Neuen Testaments in Edimburgh. Hier der Schluss, zu dem er am Ende einer über 700 Seiten langen Forschungsarbeit kommt: Die Verehrung Jesu als göttliche Gestalt explodierte plötzlich und früh, nicht schrittweise, in den Kreisen seiner Nachfolger des 1. Jahrhunderts. Genauer besehen sind die Ursprünge in den judenchristlichen Kreisen der ersten Jahre angesiedelt. Nur eine idealistische Denkweise fährt fort, die Verehrung Jesu als göttliche Gestalt dem entscheidenden Einfluss der heidnischen Religion und dem Einfluss der bekehrten Heiden zuzuweisen, indem sie sie als neu und graduell präsentiert. Die Verehrung Jesu als des Herren, die ihren angemessenen Ausdruck in der kultischen Verehrung und dem totalen Gehorsam findet, war darüber hinaus allgemein, sie war nicht auf besondere Kreise begrenzt oder nur ihnen zuzuweisen, zum Beispiel den Hellenisten oder den Heidenchristen eines hypothetischen Kultes des syrischen Christus. Bei aller Verschiedenheit im frühen Christentum war der Glaube an das göttliche Sein Jesu unglaublich gemeinsam. (L. Hurtado, Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in Earliest Christianity, Grand Rapids, Mich. 2003) Dieser rigorose historische Schluss sollte der noch immer in einer gewissen Populärliteratur verbreiteten Meinung ein Ende setzen, nach der der göttliche Kult Christi eine spätere Frucht des Glaubens sei (und per Gesetz von Konstantin in Nizäa im Jahr 325 auferlegt worden sei, wie dies Dan Brown in seinem Sakrileg behauptet). 4. Das Kind Hoffnung Neben dem Buch über Jesus von Nazareth hat uns der Heilige Vater in diesem Jahr auch die Enzyklika über die Hoffnung zum Geschenk gemacht. Jenseits seines hohen Inhalts besteht der Nutzen eines päpstlichen Dokuments auch in der Tatsache, dass es die Aufmerksamkeit aller Gläubigen auf einen Punkt konzentriert und so die Reflexion darüber anregt. In diesem Sinne möchte ich hier eine kleine geistliche und praktische Anwendung des theologischen Inhalts der Enzyklika vorlegen und zeigen, wie der Text aus dem Hebräerbrief, der Gegenstand unserer Meditation war, dazu beitragen kann, unsere Hoffnung zu nähren. In der Hoffnung so schreibt der Verfasser des Briefes mit einem wunderschönen Bild, das dazu bestimmt war, in der christlichen Ikonographie klassisch zu werden haben wir einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang; dorthin ist Jesus für uns als unser Vorläufer hineingegangen (vgl. Hebr 6,17-20). Der Grund dieser Hoffnung besteht gerade in der Tatsache, dass Gott in dieser Endzeit zu uns gesprochen hat durch den Sohn. Wenn er uns den Sohn geschenkt hat, so sagt der hl. Paulus, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? (Röm 8,32). Deshalb lässt die Hoffnung nicht zugrunde gehen (vgl Röm 5,5): Das Geschenk des Sohnes ist Unterpfand und Gewährleistung für alles andere und vor allem für das ewige Leben. Wenn der Sohn zum Erben des Alls eingesetzt ist (heredem universorum, vgl. Hebr 1,2), so sind wir seine Miterben (Röm 8,17). Die bösen Winzer des Gleichnisses sehen den Sohn ankommen und sagen zueinander: Das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben (Mt 21,38). In seiner barmherzigen Allmacht hat Gott Vater diesen kriminellen Plan ins Gute gewendet. Die Menschen haben den Sohn getötet und sind wirklich zu seinen Erben geworden! Dank dieses Todes sind sie Erben Gottes und Christi Miterben geworden. Wir Menschen brauchen die Hoffnung, um zu leben, so wie wir des Sauerstoffs bedürfen, um zu atmen. Gemeinhin sagt man: Solange man lebt, gibt es auch Hoffnung. Aber auch das Umgekehrte ist wahr: Solange es Hoffnung gibt, gibt es Leben. Die Hoffnung war für lange Zeit und sie ist es noch immer eine der theologalen Tugenden, die kleine Schwester, der arme Verwandte. Man spricht oft vom Glauben und noch öfter von der Liebe, aber sehr selten von der Hoffnung. Der Dichter Charles Péguy hat recht, wenn er die drei theologalen Tugenden mit drei Schwestern vergleicht: zwei Erwachsene und ein kleines Kind. Sie gehen auf der Straße und halten sich an den Hand (die drei theologalen Tugenden sind nicht voneinander zu trennen!), die beiden großen an den Seiten, das Kind in der Mitte. Alle, die sie sehen, sind davon überzeugt, dass es die beiden großen Schwestern sind der Glaube und die Liebe , die das Kind Hoffnung in der Mitte mit sich vorwärts ziehen. Aber sie irren: Es ist das Kind Hoffnung, das die beiden anderen vorwärts zieht; bleibt es stehen, so bleibt alles stehen. (Ch. Péguy, Il portico del mistero della seconda virtù, Oeuvres poétiques complètes, Gallimard, Parigi 1975, S. 531 ff.) Wir sehen dies auch auf menschlicher und sozialer Ebene. In Italien sind die Hoffnung und mit ihr das Vertrauen, die Lebenskraft, das Wachstum, auch das wirtschaftliche, zum Stehen gekommen. Der Niedergang, von dem gesprochen wird, rührt daher. Die Angst vor der Zukunft hat den Platz der Hoffnung eingenommen. Die wenigen Geburten sind dafür der klarste Anzeiger. Kein Land hat es nötiger, über die Enzyklika des Papstes nachzudenken, als Italien. Die theologale Hoffnung ist der Faden von oben, der vom Mittelpunkt aus alle menschlichen Hoffnungen stützt. Der Faden von oben ist der Titel einer Parabel des dänischen Schriftstellers Johannes Jörgensen. Sie erzählt von einer Spinne, die sich vom Zweig eines Baumes an einem Faden herablässt, den sie selbst produziert. Sie landete schließlich in einer Hecke, wo sie ihr Netz spinnt: ein Meisterwerk an Symmetrie und Funktionalität. Es ist an den Seiten von vielen Fäden gespannt, alles aber wird im Mittelpunkt von jenem Faden gehalten, an dem sie sich herabgelassen hat. Durchreißt man die seitlichen Fäden, so kommt die Spinne heraus, repariert den Schaden, und alles ist wieder in Ordnung. Reißt man aber jenen Faden durch, der von oben kommt (ich wollte es einmal kontrollieren und habe gesehen, dass es wahr ist), so fällt alles zusammen und die Spinne verschwindet, da sie weiß, dass nichts mehr zu machen ist. Dies ist ein Bild für das, was geschieht, wenn man den Faden, der von oben kommt und der die theologale Hoffnung ist, durchtrennt. Nur sie kann die menschlichen Hoffnungen in jener Hoffnung verankern, die nicht enttäuscht. In der Bibel können wir ein wahres plötzliches Aufblitzen der Hoffnung ausmachen. Ein derartiges findet sich im dritten Klagelied: Ich bin der Mann sagt der Prophet , der Leid erlebt hat durch die Rute seines Grimms Ich sprach: Dahin ist mein Glanz und mein Vertrauen auf den Herrn. Und siehe da: das Blitz der Hoffnung, die alles anders macht. An einem gewissen Punkt sagt der Betende zu sich selbst: Die Huld des Herrn ist nicht erschöpft, sein Erbarmen ist nicht zu Ende. Darum harre ich auf ihn. Vielleicht ist noch Hoffnung (vgl. Klgl 3,1-29). Von dem Augenblick an, in dem der Prophet beschließt, wieder zu hoffen, ändert sich der Ton vollkommen. Das Klagelied wird zum vertrauensvollen Flehen: Denn nicht für immer verwirft der Herr. Hat er betrübt, erbarmt er sich auch wieder nach seiner großen Huld (Klgl 3,32). Wir haben einen stärkeren Grund, um dieses Aufblitzen der Hoffnung zu erfahren: Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Wie sollte er uns nicht alles zusammen mit ihm schenken? Manchmal nützt es, sich selbst zuzurufen: Aber Gott gibt es, und das reicht! Der wertvollste Dienst, den die italienische Kirche in diesem Moment für das Land leisten kann, besteht darin, ihm zu helfen, das Aufblitzen der Hoffnung zu erleben. Zu diesem Ziel leistet seinen Beitrag der, der (wie es Benigni kürzlich im Fernsehen getan hat) keine Angst hat, sich dem Defätismus zu widersetzen, indem allen Italiener die vielen außerordentlichen geistlichen und kulturellen Gründe ins Gedächtnis gerufen werden, die sie haben, um in die eigenen Ressourcen ihr Vertrauen zu setzen. Das letzte Mal sprach ich von der Aromatherapie, die ihren Grund im Öl der Freude hat, das der Heilige Geist ist. Diese Therapie brauchen wir, um von der schädlichsten Krankheit von allen zu genesen: der Verzweiflung, der Mutlosigkeit, des Verlustes des Vertrauens in sich selbst, in das Leben und sogar in die Kirche. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes (Röm 15,13): so schrieb der Apostel den Römern seiner Zeit und wiederholt es den Römern von heute. Ohne die Tugend des Heiligen Geistes gibt es keine Fülle der Hoffnung. Ein afroamerikanischer Spiritual wiederholt ständig diese wenigen Worte: There is a balm in Gilead / to make the wounded whole.. Gilead oder Galahad ist eine Ortschaft des Alten Testaments, die berühmt ist für ihre Balsame und Duftöle (Jer 8,22). Das Lied fährt fort: Manchmal fühle ich mich entmutigt und denke, dass alles nutzlos ist, aber dann kommt der Heilige Geist und gibt meiner Seele neues Leben. Gilead ist für uns die Kirche, und der heilende Balsam ist der Heilige Geist. Er ist die Duftwolke, die Jesus hinter sich gelassen hat, als er auf dieser Erde weilte. Die Hoffnung ist wunderbar. Wenn sie erneut in einem Herzen erwacht, ist alles anders, auch wenn sich nichts verändert hat Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt (Jes 40, 30-31). Wo die Hoffnung wieder wächst, dort wächst vor allem die Freude. Der Apostel sagt, dass die Gläubigen spe salvi, auf die Hoffnung hin gerettet sind (vgl. Röm 8,24) und dass sie deshalb spe gaudentes, in der Hoffnung fröhlich sein müssen (vgl. Röm 12,12). Nicht Menschen, die hoffen, glücklich zu sein, sondern Menschen, die glücklich sind zu hoffen; glücklich schon jetzt, einfach deshalb, weil sie hoffen. Heiliger Vater, verehrte Väter, Brüder und Schwestern! Der Gott der Hoffnung möge uns an diesem Weihnachtsfest durch den Heiligen Geist und auf die Fürsprache Mariens, der Mutter der Hoffnung, gewähren, froh zu sein in der Hoffnung und sie in Fülle zu haben. Foto: © www.kath.net Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuJesus Christus
|  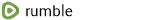  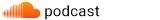 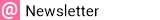 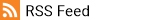 Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2024 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
