 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Europa kennt seine Wurzeln nicht mehr20. Dezember 2015 in Aktuelles, 8 Lesermeinungen Kurt Kardinal Koch: Synodalität kann nie ein Gegensatz zur Hierarchie sein. Die Rückbesinnung auf die christlichen Wurzeln Europas ist Voraussetzung für die Stärkung der Anwaltschaft gegenüber verfolgten Christen. Von Armin Schwibach Rom (kath.net/as) Familiensynode, Synodalität, Ökumene, Interkommunion und die neue Minderheit in Kirche und Welt: dies sind nur einige der Themen eines ausführlichen Gesprächs, das kath.net mit dem Präsidenten des Päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen, Kurt Kardinal Koch, auch anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes und des Endes des besonderen Jahres 2015 führen konnte. Am 15. November 2015 besuchte Papst Franziskus die evangelisch-lutherische Kirche von Rom. Auf die Frage einer Frau, die in einer gemischtkonfessionellen Ehe lebt, was getan werden könne, um beim Abendmahl die Gemeinschaft erlangen zu können, gab der Papst eine lange Antwort in freier Rede, die weltweit Aufsehen erregte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titulierte sogar: Papst ermuntert Christen zur gemeinsamen Kommunion. Franziskus betonte die Bedeutung der einen Taufe: Wie kann ich es mit meinem Mann machen, damit das Abendmahl des Herrn mich auf meinem Weg begleitet? Es ist ein Problem, auf das jeder antworten muss. Ein befreundeter Pastor sagte mir jedoch: Wir glauben, dass hier der Herr gegenwärtig ist. Er ist gegenwärtig. Ihr glaubt, dass der Herr gegenwärtig ist. Was ist der Unterschied? Nun, es sind die Erklärungen, die Deutungen Das Leben ist größer als Erklärungen und Deutungen. Nehmt immer auf die Taufe Bezug: Ein Glaube, eine Taufe, ein Herr, sagt uns Paulus, und von daher zieht die Schlussfolgerungen. Ich werde nie wagen, Erlaubnis zu geben, dies zu tun, denn es ist nicht meine Kompetenz. Eine Taufe, ein Herr, ein Glaube. Sprecht mit dem Herrn und geht voran. Ich wage nicht mehr zu sagen. Können Sie diese Aussagen des Papstes einordnen? Worin kann dieses Vorangehen bestehen? Ist nicht die Lehre eindeutig und steht sie nicht über subjektiven Befindlichkeiten? Kardinal Koch: Ich denke, dass der Papst zwei Seiten betonen wollte. Wenn er auf der einen Seite sagt, er könne nie die Erlaubnis geben, weil es nicht seine Kompetenz sei, dann bezieht er sich auf die gegenwärtige Regelung, das heißt auf die gegenwärtige Ordnung der Kirche, die er einhält. Auf der anderen Seite betont er, dass man mit dem Herrn sprechen soll, das heißt: das entscheidende Kriterium ist eine ganz persönliche, intime Beziehung mit Christus. Daraus leitet er aber keine allgemeinen Regelungen ab, sondern er gibt, denke ich, eine seelsorgliche Antwort an diese konkrete Frau. Der Papst bewegt sich damit in dieselbe Richtung, wie es der heilige Johannes Paul II. in Ecclesia de Eucharistia (2003) formuliert hat, wo er sagt: Abendmahlsgemeinschaft ist nicht möglich, aber davon zu unterscheiden sind unter ganz bestimmten Umständen Ausnahmen: wenn zum Beispiel ein geistliches Bedürfnis vorliegt: Wenn die volle Gemeinschaft fehlt so Johannes Paul II., ist die Konzelebration in keinem Fall statthaft. Dies gilt nicht für die Spendung der Eucharistie unter besonderen Umständen und an einzelne Personen, die zu Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften gehören, die nicht in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen. In diesem Fall geht es nämlich darum, einem schwerwiegenden geistlichen Bedürfnis einzelner Gläubiger im Hinblick auf das ewige Heil entgegenzukommen, nicht aber um die Praxis einer Interkommunion, die nicht möglich ist, solange die sichtbaren Bande der kirchlichen Gemeinschaft nicht vollständig geknüpft sind (Nr. 45). Diese Aussagen beruhen auf der doppelten Sicht des II. Vatikanischen Konzils, das betont hat, dass die Teilnahme an der Eucharistie immer zwei Dimensionen enthält: Sie hat eine ekklesiale und eine personale Dimension. Die ekklesiale Dimension bedeutet: die Eucharistiegemeinschaft als das Zeichen der Einheit der Kirche ist heute noch nicht möglich. Die Sakramente sind aber auch Mittel der Gnade für Menschen, die dieses geistliche Bedürfnis haben. Dieser Unterschied muss beachtet werden. Ich denke, dass sich auch auf dieser Linie die Antwort von Papst Franziskus bewegt. Sie enthält in diesem Sinn eigentlich nichts neues, sondern steht in der Linie dessen, was das kirchliche Lehramt bisher zum Ausdruck gebracht hat. Was überspitzte Aussagen in gewissen Medien betrifft, muss betont werden, dass man nicht mehr heraushören sollte, als was der Papst selbst zögernd zum Ausdruck gebracht hat. Der Papst hat ja seine Formulierungen sehr vorsichtig gewählt, wenn er, wie ich bereits gesagt habe, unterstrichen hat, dass er keine Kompetenz habe, eine Erlaubnis zu geben, und zum Schluss angefügt hat: Ich wage nicht mehr zu sagen. Es war eine seelsorgerliche Antwort und keine Änderung der Lehre der Kirche. Die offizielle Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017, Margot Käßmann, würdigte am 5. Dezember 2015 Papst Franziskus als einen Mann, der darin genial sei, mit Symbolen die kreative Kraft der konfessionellen Differenz erfahrbar zu machen, wobei sie sich wahrscheinlich auch auf das Kelchgeschenk des Papstes an die evangelische-lutherische Gemeinde bezog. Achtet man jedoch näher auf sichtbare Fortschritte in der Ökumene mit den protestantischen kirchlichen Gemeinschaften, wird man schnell erkennen können, dass es diese auch nach fast drei Jahren Pontifikat nicht gibt. Worin sehen Sie die die ökumenischen Beziehungen erneuernde Kraft des Papstes? Ist es nicht so, dass dem Papst weniger an einer Ökumene der Konfessionen gelegen ist als vielmehr an einer Bekenntnis-Ökumene? Kardinal Koch: Zunächst einmal ist festzuhalten, dass das, was die Botschafterin für das Reformationsgedenken sagt, die typische evangelische Vorstellung vom Ziel der Ökumene ist, die sie offensichtlich als die allein ökumenefähige betrachtet. Sie will die Abendmahlsgemeinschaft, jedoch keine Einheit der Kirche in dem Sinn, wie sie die Katholische Kirche sieht. Sie will nur die gegenseitige Anerkennung der gegebenen Verschiedenheit, die sie dann als produktiv bezeichnet. Diese Aussage zeigt, wie wichtig es ist, dass weiter geklärt werden muss, was unter der Einheit der Kirche als dem Ziel der Ökumene genauer zu verstehen ist. In der Tatsache, dass wir weithin keine gemeinsame Zielvorstellung der Ökumene mehr haben, liegt es auch begründet, dass wir in den katholisch-protestantischen Dialogen in den vergangenen Jahren kaum wirklich bemerkenswerte Fortschritte erreichen konnten. Was den zweiten Teil der Frage betrifft, denke ich, dass Papst Franziskus sehr daran liegt, dass die Ökumene im Dienst der gemeinsamen Verkündigung des Evangeliums steht. Dies liegt ganz auf der Linie des hohepriesterlichen Gebetes Jesu im 17. Kapitel des Johannesevangeliums: Jesus bittet, dass die Jünger eins sein sollen, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Dies heißt, dass die Einheit kein Selbstzweck in sich ist, sondern der glaubwürdigen Verkündigung des Evangeliums dient. Das ist es, worauf Papst Franziskus sehr großen Wert legt: dass wir gemeinsam unseren Glauben bekennen. Sein Ökumeneverständnis hängt sehr stark mit seinem Grundanliegen zusammen, dass die Kirche missionarisch sein muss. Hier liegt auch der Grund, dass er die Begegnung mit evangelikalen und pentekostalischen Gemeinschaften sucht. Denn mit ihnen sieht er eine gute Möglichkeit, das Evangelium gemeinsam in die Welt hinein zu tragen und zu verkünden. Wichtig ist Papst Franziskus auch, was man praktische Ökumene nennen kann: zusammenarbeiten im Dienst der Bewältigung der großen Probleme in der heutigen Welt. Gewiss gibt es bei Papst Franziskus spezifische Akzentsetzungen im ökumenischen Engagement. Doch zunächst muss man eine grundlegende Kontinuität mit seinen Vorgängern im Papstamt feststellen. Diese hat er selbst in seiner Predigt in der Vesper am 25. Januar 2014, als er zum ersten Mal dem Gottesdienst in St. Paul vor den Mauern zum Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen vorgestanden hat, betont. Er hat aufgezeigt, was die Päpste vor ihm getan haben, und daraus den Schluss gezogen, dass das Papstamt immer mehr eine ökumenische Dimension erhalten hat. Diese Aufgabe führt Papst Franziskus weiter mit gewiss spezifischen Akzentuierungen. Mit der ordentlichen Bischofssynode zu Ehe und Familie ist ein Synodenweg zu seinem Abschluss gekommen, der im Jahr 2014 mit der Ansprache von Kardinal Kasper beim Konsistorium begonnen und sich in einer außerordentlichen Synode fortgesetzt hatte. Die Synode mit ihren vor allem von den Medien betonten Reizthemen (wiederverheiratete Geschiedene, Sexualität, eheähnliche Verbindungen, homosexuelle Verbindungen) nahm im katholischen Jahr 2015 breiten Raum ein. Auch angespannte Diskussionen zu Wahrheit der Lehre und Barmherzigkeit in Liebe setzten sich fort. Von deutschen Bischöfen konnte dann gehört werden, dass die Synode die Tür einen Spalt breit für weitere Entwicklungen aufgemacht habe. Der Direktor der im Staatssekretariat gegengelesenen Zeitschrift La Civiltà Cattolica und enger Vertrauter des Papstes, Antonio Spadaro SJ, sprach sogar davon, dass die Synode eine Tür zum Sakramentenzugang für betroffene Gruppen geöffnet habe. Was hat die Synode in den umstrittenen Paragraphen 84-86 der Relatio synodi wirklich sagen wollen? Kardinal Koch: Nun, es gibt das Wort deutscher Bischöfe, es gibt die Wortmeldung des Direktors von La Civiltà Cattolica aber die polnischen Bischöfe zum Beispiel sprechen davon, dass es bei der bisherigen Praxis bleibt. Das zeigt, dass dieser Text sehr verschieden interpretiert werden kann. Daher muss sehr genau geschaut werden, was er eigentlich sagt. Über den Sakramentenempfang ist explizit nichts ausgesagt. Es geht vielmehr um die grundlegende Aussage, dass die Lebenssituationen der wiederverheirateten Geschiedenen sehr unterschiedlich betrachtet werden müssen. Damit wird wieder aufgegriffen, was bereits Papst Johannes Paul II. in Familiaris consortio (Nr. 84) angemahnt hat. Diese Anweisung ist in der Tat sehr wichtig, weil die Lebenssituationen von wiederverheiratet Geschiedenen in der Tat sehr unterschiedlich sind. Vom Sakramentenempfang ist aber nicht die Rede. Hinzu kommt, dass es bei der Schlussabstimmung am Ende der Synode bei kaum einer Frage so viele Gegenstimmen gegeben hat wie bei diesen Paragraphen 84-86. Die Zweidrittel-Mehrheit wurde zwar nicht in Frage gestellt. Die vielen Nein-Stimmen sind aber doch ein deutliches Zeichen dafür dass hier noch tiefer gefragt werden muss. Die Frage des Sakramentenempfangs ist nach wie vor offen, und ich denke, dass dazu der Heilige Vater noch Stellung nehmen wird. Meines Erachtens sind noch einige Fragen offen, die für den Weg der Nichtigkeitserklärung von wichtiger Bedeutung sind. Ich sehe Klärungsbedarf vor allem bei zwei Fragen. Die erste betrifft das Problem, das bereits Papst Benedikt XVI. aufgeworfen hat: welche Rolle spielt der Glaube beim Zustandekommen des Ehebandes? Wie man den Glauben prüfen kann, ist natürlich eine schwierige Frage. Auf der anderen Seite gibt es aber keine Feier der Sakramente ohne Glauben. Die Frage nach der Bedeutung des Glaubens beim Eingehen einer Ehe muss deshalb noch intensiv studiert werden. Die zweite Frage betrifft die Aussage im Kirchenrecht, dass jede unter Getauften geschlossene Ehe ein Sakrament ist. Was aber bedeutet diese Aussage für Menschen in anderen christlichen Kirchen, die von der Sakramentalität der Ehe gar nicht überzeugt sind? Auch dies ist eine offene Frage, die weiter zu studieren und einer Entscheidung entgegen geführt werden muss. Wenn ich von dem ausgehe, was im Text der Relatio synodi gesagt ist, kann ich im Blick auf die Frage des Sakramentenempfangs für die wiederverheirateten Geschiedenen noch keine definitive Antwort erkennen. Es ist gewiss keine Türe geschlossen worden, und die Offenheit von Familiaris consortio ist gewahrt. Die weiteren Entscheidungen liegen in der Verantwortung des Papstes. Es ist selbstverständlich, dass die kirchliche Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe nicht geändert werden kann. Auf der anderen Seite berühren die beiden von mir genannten offenen Fragen Sakrament und Glaube und Sakramentalität der Ehe auch die Lehre von der Ehe. Insofern kann man nicht in einem absoluten Sinn sagen, dass es keine Vertiefung der Ehelehre aufgrund von neuen Situationen, mit denen die Kirche heute konfrontiert ist, geben könne. Dabei kann es aber nicht um eine Veränderung der grundlegenden Aussagen der kirchlichen Lehre geben. Eine solche Veränderung ist nicht möglich. Am 17. Oktober erklärte Papst Franziskus in seiner Ansprache bei der Fünfzigjahr-Feier der römischen Bischofssynode, das die Synodalität eine konstitutive Dimension der Kirche sei und den geeignetsten Interpretationsrahmen für das Verständnis des hierarchischen Dienstes selbst bietet. Worin besteht diese Synodalität? Da die Jahre 2014 und 2015 ganz von einem synodalen Prozess bestimmt waren, der zweifellos auch Verwirrung mit sich brachte wie muss man sich eine synodale Kirche der Zukunft vorstellen? Als verbeulte Kirche? Läuft es darauf hinaus, lokalen Bischofskonferenzen Kompetenzen zu überlassen? Kardinal Koch: Dass die Kirche hierarchisch und synodal zugleich verfasst ist, gehört zur Grundüberzeugung der Katholischen Kirche. Die entscheidende Frage besteht darin, wie Hierarchie und Synodalität zusammengehen und was unter Synodalität zu verstehen ist. Denn nicht alles, was heute als synodal bezeichnet wird, kann als synodal im theologischen Sinn bezeichnet werden. Die Verwirrung, von der Sie gesprochen haben, ist vielleicht eher ein Zeichen dafür, dass der tiefere Sinn der Synodalität noch nicht ganz erfasst ist. Es besteht vor allem ein wesentlicher Unterschied zwischen Synodalität und Demokratie. Demokratie ist das Verfahren zur Ermittlung von Mehrheiten, die dann entscheiden. Synodalität ist demgegenüber das Bemühen, solange miteinander zu ringen, bis Einmütigkeit gefunden ist und keiner mehr behaupten kann, es liege ein Gegensatz zum Glauben vor. Solche Synodalität ist mühsam, und verglichen mit ihr ist Demokratie eigentlich ganz einfach. In dieser Richtung, so denke ich, haben wir bei der Klärung dessen, was Synodalität in der Kirche bedeutet, noch einen gewissen Klärungsbedarf. Synodalität kann nie ein Gegensatz zur Hierarchie sein. Die Hierarchie ist vielmehr die Voraussetzung für das Gelingen von Synodalität. Die ist in meinen Augen auch bei der vergangenen Bischofssynode sichtbar geworden: Wenn die Synodenväter hätten entscheiden können, dann wäre es vielleicht zu noch größeren Spannungen und möglicherweise sogar zu Lagerbildungen gekommen, die dann versucht hätten, die eigenen Standpunkte durchzusetzen. Da Synodalität aber bedeutet, dass die Synodenväter solange miteinander ringen, bis sie dem Papst ein gutes Ergebnis vorlegen können, damit er eine sinnvolle Entscheidung fällen kann, dann zeigt gerade die Synode die Notwendigkeit des Papstamtes und dass Synodalität und Hierarchie zusammengehören. Papst Franziskus hat sich bisher in einem sehr grundsätzlichen Sinn geäußert, dass die Kirche mehr Synodalität braucht. Er hat aber noch nicht genau zum Ausdruck gebracht, was er konkret darunter versteht. Ich habe festgestellt, dass in der Öffentlichkeit aus den Aussagen des Papstes sofort geschlossen wurde, dass er die nationalen Bischofskonferenzen stärken will. Mein Eindruck ist aber, dass Papst Franziskus eher von seiner bisherigen Erfahrung mit den kontinentalen Bischofskonferenzen und ihren grossen Versammlungen in Puebla, Medellin, Aparecida her denkt. In meinen Augen darf Synodalität nicht auf die nationalen Bischofskonferenzen fixiert werden, sondern muss darüber hinaus gehen, weil die Nation eigentlich keine kirchliche Kategorie darstellt. Zudem muss noch genauer gefragt werden, was auf den regionalen Ebenen synodal geregelt werden könnte. Dies betrifft sicher nicht Fragen des Glaubens und Fragen des geweihten Amtes in der Kirche. Diesbezüglich müssen wir auch aus der Geschichte lernen: Das Zweite Vatikanische Konzil hat beispielsweise nur entschieden, dass der Ständige Diakonat wieder eingeführt werden kann. Dieses neue Amt ist aber von verschiedenen Ortskirchen und Bischofskonferenzen verschieden entfaltet worden. So hat beispielsweise dieses Amt in Deutschland und in der Schweiz eine ganz andere Entwicklung genommen, so dass es über Landesgrenzen hinaus kaum mehr austauschbar ist. Darin zeigt sich ein Mangel an Katholizität, der nicht das Ergebnis von Synodalität sein darf. Die Aussage des Papstes über die Synodalität ist deshalb noch nicht die Antwort auf die Probleme, sondern formuliert eine Aufgabe, die noch intensiv studiert werden muss, wie der Papst ja selbst angesprochen hat. Es muss danach gefragt werden, was Dezentralisierung genau heißt und was dezentral entschieden werden kann. Vor allem kann Synodalität kein Gegensatz zum hierarchischen Prinzip in der Kirche sein. Meine Erfahrung in den ökumenischen Dialogen zeigt mir vielmehr: eine starke Synodalität braucht auch einen starken Primat! Der Erzbischof von New York, Timothy Kardinal Dolan, erinnerte am 12. Oktober 2015 und somit während der Bischoffsynode in einem Beitrag auf seinem Blog daran, dass es inzwischen eine neue Minderheit in der Welt gebe, ja sogar in der Kirche. Gemeint sind jene, die in Ehe und Familie im Vertrauen auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit nach Tugend und Treue streben: Jene Paare, die trotz der Tatsache, dass zumindest in Nordamerika überhaupt nur die Hälfte unserer Leute das Ehesakrament empfängt, die Kirche um dieses Sakrament bitten; Jene Paare, die inspiriert von der kirchlichen Lehre der Dauerhaftigkeit der Ehe in Versuchungen durchgehalten haben; Paare, die die Gottesgabe vieler Kinder willkommen heißen. Ein junger Mann und eine junge Frau, die sich entschieden haben, vor der Hochzeit nicht zusammen zu leben. Ein homosexueller Mann oder eine homosexuelle Frau, die enthaltsam leben wollen. Das Paar, das entschieden hat, dass die Ehefrau auf eine verheißungsvolle berufliche Karriere verzichtet, um zu Hause zu bleiben und die Kinder aufzuziehen diese wundervollen Leute fühlen sich heutzutage als eine Minderheit, mit Sicherheit in unserer Kultur, gelegentlich aber auch innerhalb der Kirche! Ich glaube, dass es mehr von ihnen gibt als wir denken, doch unter dem heutigen Druck fühlen sie sich oft ausgeschlossen. Dieses von Dolan dargestellte Problem der neuen Minderheit ist auch gerade im deutschsprachigen Raum spürbar: das Problem eines gewissen Verlassenseins gerade seitens der Hirten (Bischöfen, Priestern). Was würden Sie diesen Gläubigen sagen? Kardinal Koch: Ich stimme Kardinal Dolan zu und teile seine Wahrnehmung. Die Katholiken, die ganz nach der Lehre der Kirche und ihren Glaubensüberzeugungen leben, verdienen eine besondere Wertschätzung und auch Dankbarkeit für ihr Lebenszeugnis. Wenn sie sich als Minderheit auch in der Kirche fühlen, dürfen sie nicht resignieren. Sie sind aber auf die Unterstützung der andern Kirchenglieder und in besonderer Weise der Hirten angewiesen. Natürlich gehört es zur Hirtensorge der Bischöfe, dass sie sich um die Menschen kümmern, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden und teilweise auch in Kontrast zur Lehre der Kirche leben. Darin besteht schlicht ihre Hirtenaufgabe. Dabei dürfen sie aber jene Menschen, die treu zu den Glaubensüberzeugungen der Kirche stehen, nicht vernachlässigen, sondern müssen sie ermutigen, ihren Weg weiter zu gehen, und sie müssen ihnen auch pastorale Hilfen geben, wie sie ihren Weg gehen können. Vielleicht liegt ein Problem auch darin, dass die Gläubigen, die treu zur Lehre der Kirche stehen und sie leben, sich eher still verhalten und ihr Glaubenszeugnis eher durch das Leben als durch Worte geben, wohingegen sich andere Gruppierungen in der Öffentlichkeit lautstark vernehmen lassen. Dadurch wird ihre Minderheitensituation freilich nochmals verstärkt. Sie müssen deshalb auch ermutigt werden, gegenüber ihren Priestern und Bischöfen ihre Anliegen und Hilfestellungen, die sie sich wünschen, deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Stichwort Christenverfolgung und Ökumene der Märtyrer. In einem denkwürdigen Vortrag haben Sie sich am 17. November mit diesem Thema auseinandergesetzt und bezeichneten mit einem Wort des Katechismus der Katholischen Kirche die Märtyrer als mit Blut geschriebene Archive der Wahrheit. Gibt es auch eine Ökumene christlicher Anwaltschaft für die verfolgten Christen, in einer Zeit, da wie Papst Franziskus immer wieder betont die um ihres Glaubens willen verfolgten Christen zahlreicher sind als in den ersten Jahrhunderten? Kardinal Koch: Die ökumenische Anwaltschaft für die verfolgten Christen ist die logische Konsequenz, die sich aus der Ökumene der Märtyrer ergibt. Denn die Wahrnehmung, dass achtzig Prozent aller Menschen, die in der heutigen Welt wegen ihres Glaubens verfolgt werden, Christen sind, muss die Solidarität unter allen Christen wecken, so dass sie sich weltweit für die verfolgten Christen einsetzen. Bereits die Wahrnehmung der Ökumene der Märtyrer scheint mir freilich heute noch immer zu schwach zu sein, wiewohl sie eine lange Geschichte hat. Sie geht auf den heiligen Papst Johannes Paul II. zurück, der von sich bekannt hat, dass er zwei Erfahrungen von Diktaturen, nämlich der braunen und der roten, gemacht und dabei gesehen hat, dass die Diktatoren keinen Unterschied zwischen Orthodoxen, Protestanten und Katholiken machen, und dass er da gelernt habe, dass wir Christen zusammen gehören. In meinen Augen liegt hier die tiefste Wurzel des großen ökumenischen Engagements von Papst Johannes Paul II. In einer guten Kontinuität spricht Papst Franziskus heute von der Ökumene des Blutes. Ich habe allerdings nicht den Eindruck, dass diese wichtige Form des Ökumenismus von den Christen bereits in genügender Weise wahrgenommen würde. Ihre Wahrnehmung ist freilich die unbedingte Voraussetzung, um ökumenische Anwartschaft und Solidarität mit den verfolgten Christen zu üben. Ich habe den Eindruck, dass die öffentliche Wahrnehmung noch immer von der Skandalgeschichte des Christentums dominiert ist, genauer von der kriegerischen Geschichte, die es im Christentum auch gegeben hat. Diese darf gewiss nicht verdrängt werden. Wenn wir heute sehen, dass die konfliktuösen Auseinandersetzungen zwischen Schiiten und Sunniten eine Wurzel von viel Gewalt im Islam sind, werden wir Christen unwillkürlich daran erinnert, dass es auch zwischen Protestanten und Katholiken grausame kriegerische Auseinandersetzungen gegeben hat, vor allem in den blutigen Konfessionskriegen im 16. und 17. Jahrhundert und im Dreißigjährigen Krieg, der Europa in ein Blutbad verwandelt hat. Diese schreckliche Geschichte dürfen wir gewiss auch im Blick auf das bevorstehende Reformationsgedenken nicht verdrängen. Auf der anderen Seite darf aber die Erinnerung an die Geschichte uns in keiner Weise daran hindern, uns gegen die Verfolgung der Christen heute in der Öffentlichkeit stark zu machen und unseren Brüdern und Schwestern, die unter Verfolgungen leiden, unsere besondere Solidarität kund zu tun. Auch dies sollten wir aus der Geschichte lernen. Ich bin nicht überzeugt, dass die europäische Politik die Realität und das Ausmaß der Christenverfolgungen heute in genügender Weise wahrnimmt. Dieser Mangel hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass Europa seine christlichen Wurzeln weithin nicht mehr kennt oder gar verdrängt und damit in eine tiefe Identitätskrise hinein geraten ist. Eine Folge davon besteht in der ungenügenden Bereitschaft zur Verteidigung der verfolgten Christen in der heutigen Welt. Die Rückbesinnung auf die christlichen Wurzeln Europas ist insofern eine wichtige Voraussetzung, um die Anwaltschaft gegenüber den verfolgten Christen zu stärken. Am 10. Dezember veröffentlichte die Kommission für die Beziehungen mit dem Judentum Ihres Dikasteriums ein neues Dokument. Das Schreiben trägt den Titel Warum die Gnade und die Berufung Gottes unwiderruflich sind (Röm 11,29). Überlegungen zu theologischen Fragen zu den katholisch-jüdischen Beziehungen anlässlich des 50. Jahrestages von Nostra Aetate. Worin bestehen neue oder erneuerte Kernlinien, die das Dokument für die Beziehungen zwischen Christentum und Judentum abzeichnet? Kardinal Koch: Das Dokument hat zwei Grundanliegen. Es will erstens zurückblicken auf die vergangenen fünfzig Jahre des Dialogs zwischen Katholiken und Juden und gleichsam dankbar die Ernte dieses Bemühens einbringen. Zweitens will das Dokument künftige Dialoge anregen, wobei es vor allem darum geht, die theologischen Fragen zu vertiefen. Die grundlegendste theologische Frage besteht darin, wie die Glaubensüberzeugung der Juden, die von uns Christen geteilt wird, dass der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, nie zurück genommen worden ist, sondern auch heute gültig ist, mit der Grundüberzeugung der Christen, dass mit Jesus Christus etwas Neues in die Welt gebracht worden ist, so miteinander versöhnt werden können, dass Juden und Christen sich in ihren Glaubensüberzeugungen nicht verletzt fühlen. Ich glaube nicht, dass wir auf diese schwierige und sensible Frage bereits eine wirklich tragfähige Antwort gefunden haben. Mir scheint deshalb die Zeit reif, dass wir viele theologische Fragen, die sich im jüdisch-katholischen Dialog stellen, vertiefen. Dass dies dringend notwendig ist, ist mir vor allem deutlich geworden bei den Reaktionen auf die von Papst Benedikt XVI. vorgenommene Neuformulierung der Karfreitagsfürbitte für die Juden in der außerordentlichen Form des Römischen Ritus. Benedikt hat damals die Glaubensaussage des Paulus in seinem Brief an die Römer in Gebetssprache übersetzt und sie als Bitte um das eschatologische Handeln Gottes am Ende der Zeiten formuliert. Diese sehr tiefe Karfreitagsfürbitte ist aber in der Öffentlichkeit als Aufruf zur geschichtlichen Judenmission weitgehend missverstanden worden. Statt genau hinzusehen, was der Papst wirklich gesagt hat, ist die Karfreitagsfürbitte aufgrund von Missverständnissen und falschen Interpretationen vor allem auf Ablehnung gestoßen. An diesem Beispiel ist mir besonders deutlich geworden, dass solche sensible und schwierige Fragen zunächst im jüdisch-katholischen Dialog, gleichsam in camera caritatis besprochen werden müssen, damit sie in einer breiteren Öffentlichkeit freimütig und sachgemäß diskutiert werden können. Es freut mich, dass sich heute auch unter den Rabbinern die Stimmen mehren, die eine Vertiefung von theologischen Fragen für wichtig halten, wie jüngst eine sehr positive und erfreuliche Stellungnahme von über zwanzig orthodoxen Rabbinern zum jüdisch-christlichen Dialog gezeigt hat. Das neue vatikanische Dokument steht deshalb nicht am Ende eines Weges, sondern bildet den Anfang einer neuen Wegstrecke. Es handelt sich dabei aber nicht um ein Dokument des kirchlichen Lehramtes, sondern um ein Studiendokument der Vatikanischen Kommission für die religiösen Beziehungen mit dem Judentum, und zwar mit dem Ziel, den Dialog zwischen Katholiken und Juden über ihre Glaubensüberzeugungen zu vertiefen. Ich danke Ihrer Eminenz für das Gespräch und die Zeit, die Sie den Lesern geschenkt haben. Gleichzeitig wünsche ich von ganzem Herzen eine gute verbleibende Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest! Kurt Kardinal Koch über Christenverfolgung Foto Kardinal Koch (c) kath.net/Petra Lorleberg Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuKoch Kardinal
|  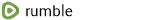  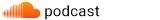 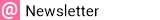 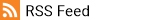 Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||

