 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Hirntod und Transplantationsmedizin: Sterben als soziales Konstrukt?14. März 2017 in Kommentar, 12 Lesermeinungen Man braucht also für die Organspende Lebende, die zugleich tot sein müssen. Wie kann das funktionieren? Gastbeitrag Teil 1 Von Prof. Axel W. Bauer Mannheim (kath.net) Dieser Vortrag wurde am 15. Dezember 2016 an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg gehalten - Teil 1 1. Grenzen und Entgrenzung in Politik und Wissenschaft Als mich Ladislaus Ludescher im Mai 2016 darum bat, zur Interdisziplinären Vortragsreihe Grenzüberschreitungen und Wendepunkte im Wintersemester einen Beitrag aus meinem Fachgebiet, der Medizinethik, beizusteuern, war ich gerade mit den Korrekturfahnen eines neuen Buches beschäftigt, das vor wenigen Wochen unter dem Titel Normative Entgrenzung. Themen und Dilemmata der Medizin- und Bioethik in Deutschland erschienen ist.1 Ich betrachte es daher als eine glückliche Fügung, dass ich Ihnen heute über normative Konstruktions- und Entgrenzungsprozesse im Zusammenhang mit dem Hirntodkonzept und der Transplantationsmedizin aus der natürlich individuellen und keineswegs dogmatisch unbestreitbaren Perspektive eines Medizinethikers berichten darf. Spätestens seit dem Herbst 2015 beschäftigt uns gerade in Deutschland das Thema Grenzen und deren politisch forcierte Öffnung in einer ganz realen topographischen, demographischen und sozialen Bedeutung. Ähnlich wie vor zwei Jahrzehnten mit dem Aufkommen des Internet (ein Wort übrigens, das 1996 erstmals im Duden auftauchte) der Begriff der Vernetzung plötzlich in aller Munde war, bis er heute zu einer oft arg strapazierten, populären Metapher geworden ist, hat das Thema Grenzen und deren Auflösung, die Entgrenzung, derzeit durchaus das Potenzial, zu einem neuen interdisziplinären Reflexions- und Diskursfokus zu werden. Doch während das Netz und die Vernetzung eine eher positive Konnotation erhalten haben, sieht es bei den Grenzen anders aus. Die Protagonisten der Entgrenzung nutzen dies ist jedenfalls mein Eindruck mehr oder minder subtil das immer noch wirkungsvolle Schreckbild des im November 1989 geöffneten Eisernen Vorhangs zwischen Ost und West, insbesondere in Form des Todesstreifens zwischen der DDR und der damaligen Bundesrepublik Deutschland, um Grenzen ganz generell als abstoßende, einengende, tödliche und in jedem Fall zu überwindende Einrichtungen darzustellen. Der Held der vor diesem Hintergrund mit suggestiver Kraft erzählten Geschichten ist dann stets derjenige, der wie einst US-Präsident Ronald Reagan (1911-2004) am 12. Juni 1987 vor dem Brandenburger Tor in Berlin rhetorisch brillant fordert: Mr. Gorbachev, tear down this wall! Nicht immer jedoch müssen Grenzen aus der Perspektive desjenigen betrachtet werden, der sie niederreißen möchte. Grenzen haben schließlich oft auch eine schützende Funktion, wie etwa eine Hecke im Vorgarten oder die mittelalterliche Stadtmauer, die eine Abwehrfunktion nach außen besaß. In der Ethik sprechen wir analog dazu von normativen Grenzen, die wir uns setzen, um Gutes von Schlechtem zu unterscheiden. Solche Grenzen jedoch stehen gerade in den westlichen Industrienationen seit vielen Jahren zur Diskussion. Dieses Phänomen wiederum gab den Anlass zur Publikation meines Buches. Die Idee dazu entstand am 19. September 2014 auf einer Eisenbahnfahrt von Frankfurt am Main nach Berlin, die ich gemeinsam mit einer Kollegin angetreten hatte. Wir waren auf dem Weg zu einer medizinethischen Fachtagung, deren Thema der assistierte Suizid war, dessen für den Herbst 2015 geplante strafrechtliche Regulierung zu diesem Zeitpunkt als ein heißes Eisen im Fokus des kontrovers geführten biopolitischen oder besser des thanatopolitischen Diskurses in Deutschland stand. Meine Mitreisende lenkte das Gespräch auf die nach ihrer Meinung doch recht umfangreichen Erfahrungen mit Wissenschaftlern und Politikern, vor allem aber mit strittigen Themen, die ich in den letzten zwei Jahrzehnten meiner Tätigkeit im Bereich der Medizin- und Bioethik wie auch zwischen 2008 und 2012 als Mitglied des Deutschen Ethikrates gesammelt hätte. Ob ich diese Erfahrungen denn nicht einmal in Form einer Monografie ordnen und veröffentlichen wolle? Als einem Medizinethiker, dessen akademische Laufbahn als Medizinhistoriker begonnen habe, müsse es mich doch reizen, den Blick auf die aktuelle Medizin- und Bioethik mit einer Rückschau auf die vergangenen zwanzig Jahre zu kombinieren, in denen es eine erhebliche Dynamik in der thematischen Entwicklung des bioethischen und biopolitischen Diskurses gegeben habe. Es sei geradezu eine normative Entgrenzung der Lebenswissenschaften in Gang gebracht worden, speziell auf den Beginn und das Ende des menschlichen Lebens bezogen, die ich doch einmal aus der Perspektive eines Zeitzeugen beschreiben könnte. In den folgenden Monaten begann ich über die Wendungen und Wandlungen in der Medizin- und Bioethik nachzudenken. Nach und nach ergab sich dabei eine formale Struktur, eine thematische Matrix. Eine wichtige Rolle kam dabei jenen drei Problemkreisen zu, die während der vergangenen beiden Jahrzehnte den medizin- und bioethischen Diskurs wie auch die daran anknüpfende Biopolitik in Deutschland aber nicht nur hier besonders stark und nachhaltig geprägt haben. Diese Themen betreffen die Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen sowie die zunehmende Erosion des vom Staat zu gewährleistenden Lebensschutzes am Beginn und am Ende des menschlichen Lebens. Wenn ich an zahlreichen Beispielen beschreibe, dass sich zumindest der medizinethische Mainstream einflussreichen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Interessengruppen beim Niederreißen normativer Grenzen gegenüber derzeit allzu dienstbar erweist, dann bezieht sich diese These in besonderer Weise auf die Entwicklung des ethischen, juristischen und biopolitischen Diskurses auf diesen drei Themenfeldern. Es fällt auf, dass auf der argumentativen Vorderbühne, der Front of House im Sinne des Soziologen Erving Goffman (1922-1982), vor allem hehre und äußerst positiv konnotierte Begriffe wie Ethik des Heilens oder Respekt für die Selbstbestimmung geradezu obsessiv ins Zentrum der Debatten gerückt werden, während es hinter den Kulissen, also Backstage, häufig darum geht, den Schutz des menschlichen Lebens im Interesse der biologischen Forschung einerseits so spät wie möglich beginnen, ihn andererseits aber unter dem Druck demografischer und vermeintlicher ökonomischer Notwendigkeiten eher früh enden zu lassen. Medizin- und Bioethik, die dem Wortsinn nach Bereichsethiken des Heilens beziehungsweise des Lebendigen schlechthin sein sollten, verwandeln sich vor unseren Augen allmählich in Disziplinen, die allzu oft den Tod im Gepäck haben, dessen vorzeitige Herbeiführung sie auch noch philosophisch zu rechtfertigen suchen. 2. Wozu dienen normative Grenzen? Kinder brauchen Grenzen. So nannte der Kommunikationsberater Jan-Uwe Rogge (*1947) seinen 1993 erschienenen Pädagogik-Bestseller.2 Doch wie sieht es eigentlich mit der Weiterführung dieses Gedankens aus: Kinder brauchen Grenzen Erwachsene vielleicht auch? In der griechischen Antike waren es die Götter im Olymp, die den menschlichen Frevel der Hybris bestraften. Was aber sollte der Sinn eines derartigen Delikts in unserer von Göttern und von Gott bereinigten, säkularen und pluralistischen High-Tech-Welt noch sein? Wo es keine Götter mehr zu geben scheint, da bleibt auch für den Begriff der Hybris ebenso wenig Raum wie für denjenigen der Gottebenbildlichkeit. Erwachsene respektieren heute keine ethischen und ästhetischen Grenzen mehr, und nach einem bekannten Spruch ist dies alles angeblich auch gut so. Ein Kind mit angeborener Behinderung unzumutbar für Eltern und gesetzeskonform vermeidbar dank (jetzt sogar nichtinvasiver) Pränataldiagnostik (PND) mit anschließender Abtreibung. Siechtum und Leiden durch Multiple Sklerose, Morbus Parkinson oder Diabetes mellitus wozu haben wir die Forschung an embryonalen Stammzellen! Jene paar Millionen dazu nötiger gespendeter Eizellen und überzähliger Embryonen, die dabei verbraucht werden, tun uns ja nicht weh. Der kranke Tim braucht einen Knochenmarkspender? Mithilfe der Präimplantationsdiagnostik machen wir ihm ein immunkompatibles Brüderchen. Der Kölner Psychiater Manfred Lütz (*1954) schrieb schon zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts, die uralte Sehnsucht des Menschen nach Gott und dem ewigen Leben agiere sich heute beim Thema Gesundheit aus; so habe die Kostensteigerung im Gesundheitswesen letztlich religiöse Gründe.3 Im Hinblick auf die ethisch ebenfalls brisante Frage Wie tot sind Hirntote?, der ich mich im Folgenden zuwende, wird in der öffentlichen Debatte über gewisse Fakten und Zusammenhänge, die eigentlich auf der Hand liegen, geschwiegen, einfach deshalb, weil zu wenig nach ihnen gefragt wird. Wie ist hier die Ausgangslage? Infolge des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts ist es der Medizin in den vergangenen 50 Jahren gelungen, immer mehr Organe des Menschen mit steigendem Behandlungserfolg zu transplantieren. So wurden im Jahre 2011 in Deutschland von insgesamt 1.200 hirntoten Organspendern 2.055 Nieren, 1.128 Lebern, 366 Herzen und 337 Lungen auf erkrankte Organempfänger übertragen.4 In den letzten vier Jahren sind diese Zahlen allerdings deutlich gesunken. Zu den Gründen dafür komme ich später. Die Transplantationschirurgie steht ja immer vor der grundsätzlichen Schwierigkeit, dass die Spenderorgane nur kurze Zeit ohne unmittelbare Verbindung mit einem aktiven Blutkreislauf funktionsfähig und damit für eine Übertragung geeignet bleiben. Dieser Zustand kann bei regenerativen Organen, zum Beispiel bei der Leber oder dem Knochenmark, oder bei doppelt vorhandenen Organen wie zum Beispiel den Nieren durch eine Lebendspende erreicht werden. 2014 wurden 619 Nierentransplantationen in Deutschland nach einer Lebendspende vorgenommen, das waren immerhin 28,8 Prozent.5 Bei den Lebertransplantationen erreichte der Anteil der Lebendspenden (45 Fälle) im Jahre hingegen 2015 nur rund 5 Prozent.5 Besonders häufig stellen sich Eltern als Lebendspender für ihre erkrankten Kinder zur Verfügung. Bei den meisten anderen Organen, zum Beispiel dem Herzen oder der Bauchspeicheldrüse, kommt indessen nur die Spende aus einem lebenden Organismus mit funktionierendem Blutkreislauf infrage, der ohne das gespendete Organ selbst nicht mehr weiterleben kann. Man braucht also für die Organspende Lebende, die zugleich tot sein müssen. Wie kann das funktionieren? Um das aus diesem Paradoxon resultierende ethische und rechtliche Dilemma normativ zu entschärfen, wurde im Jahre 1968 an der Universität Harvard eine neuartige Definition des Todes entwickelt. Man war damals bestrebt, einen Zeitpunkt vor dem bis dahin allgemein akzeptierten Todeszeitpunkt, also dem vollständigen, medizinisch irreversiblen Erlöschen der Herztätigkeit und dem dauerhaften Stillstand des Blutkreislaufs zu finden, der künftig für die Zwecke der Intensivmedizin und der Organspende als der Tod des Menschen bezeichnet werden konnte. Das Ergebnis dieser Bemühungen war die sogenannte Hirntoddefinition. Diese ging und geht bis heute davon aus, dass in dieser Lage zwar nicht sämtliche Lebensfunktionen insbesondere Herztätigkeit und Kreislauf endgültig erloschen sind, dass aber wegen einer als irreversibel angesehenen Schädigung des Gehirns und des Ausfalls seiner gesamten integrativen Funktionen das Sterben und damit der Todeseintritt jedenfalls unumkehrbar sei. Die vor 48 Jahren entwickelte Definition ist heute weltweit medizinischer Standard. Sie wurde auch im 1997 erlassenen deutschen Transplantationsgesetz (TPG) verankert. In § 3 Absatz 2 TPG heißt es dazu: Die Entnahme von Organen oder Geweben ist unzulässig, wenn [ ] 2. nicht vor der Entnahme bei dem Organ- oder Gewebespender der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach Verfahrensregeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, festgestellt ist.7 4. Die gesetzliche Neuregelung der Organspende im Jahre 2012 Im Jahre 2012 wurde im Hinblick auf das Ende des Lebens ein konkreter gesetzlicher Schritt zur weiteren Verdinglichung und Verwertung des menschlichen Körpers getan. Die Fraktionsvorsitzenden aller im Bundestag vertretenen Parteien hatten sich am 1. März 2012 mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (*1976) auf einen Gesetzentwurf zur Änderung des Transplantationsgesetzes geeinigt, der zusammen mit einem weiteren Änderungsgesetz der Bundesregierung am 25. Mai 2012 mit überwältigender Mehrheit vom Deutschen Bundestag angenommen wurde.8 Dadurch wurde die bis dahin geltende erweiterte Zustimmungslösung mit Wirkung vom 1. November 2012 in eine Entscheidungslösung transformiert. Die gesetzlichen und privaten Krankenkassen wurden verpflichtet, zunächst alle zwei Jahre und nach der Entwicklung einer entsprechend speicherfähigen elektronischen Gesundheitskarte schließlich alle fünf Jahre ihre Versicherten anzuschreiben und deren Bereitschaft zur Organspende abzufragen.9 Das neue Gesetz hat eine Zwangsbefragung aller Bürger und Bürgerinnen eingeführt, um die Zahl der Organspender zu erhöhen. Die in stillem Einvernehmen einer Allparteienkoalition gefundene Übereinkunft erscheint Kritikern jedoch aus drei Gründen bedenklich: 2. Die regelmäßige Abfrage durch die Krankenkassen und die Dokumentation der Antworten in der elektronischen Gesundheitskarte bedrängen und bevormunden die Bürger. Sie werden durch den Staat, und dies immer wieder, zu einer für sie höchstpersönlichen, intimen Entscheidung auf Leben und Tod aufgefordert. Dies geschieht in einer Intensität, die im Einzelfall, zum Beispiel bei depressiven, kranken, behinderten oder alten Menschen, gefährlich und unverantwortlich ist. Wenn die Krankenkassen alle Versicherten ab 16 Jahren, das heißt auch Jugendliche, akut Schwerkranke, chronisch Kranke, suizidal Gefährdete oder Behinderte, regelmäßig anschreiben und deren Bereitschaft zur Organspende erfragen, so stellt dies einen rechtfertigungsbedürftigen Eingriff in die psychische Integrität der Person dar. Die Erfassung aller Bürgerentscheidungen zur Organspende respektiert keinesfalls deren Freiwilligkeit, vielmehr übt der Staat moralischen Druck auf die Bürger durch deren lebenslänglich wiederholte Befragung aus. Eine repräsentative Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aus dem Jahre 2016 zeigt ein ambivalentes Zwischenergebnis: Zwar akzeptieren 81 Prozent der Bevölkerung die Organ- und Gewebespende, und fast 60 Prozent der Deutschen haben eine eigene Entscheidung getroffen, zu 74 Prozent zustimmend. Es gibt auch einen wachsenden Trend, die Einstellung zur Organ- und Gewebespende in Form eines Organspendeausweises schriftlich zu dokumentieren. Immerhin 36 Prozent der Befragten haben bis 2016 einen solchen ausgefüllt, noch 2012 waren es nur etwa 20 Prozent gewesen. 42 Prozent der Befragten wünschten sich aber noch mehr Informationen über das Thema.10 5. Skandalöse Organvergabepraxis nur Einzelfälle? Gerade in den vergangenen vier Jahren drängte sich indessen der Eindruck auf, dass die Organvergabepraxis durchaus als ein lukratives Geschäft angesehen wird, und das sogar in deutschen Universitätsklinika. So wurden im Juli 2012 Vorwürfe bekannt, wonach Laborwerte von Patienten, die auf eine Spenderleber warteten, gefälscht worden seien, um diese in der offiziellen Warteliste nach oben rücken zu lassen. Auch sei illegal Geld an Ärzte geflossen, um die gewünschten Transplantationen zu beschleunigen.11 Ferner, so lauteten 2012 weitere Vorwürfe, hätten Kliniken immer häufiger Spenderorgane in einem beschleunigten Verfahren an selbst ausgesuchte Patienten vergeben. So sei 2012 jedes vierte Herz, jede dritte Leber und jede zweite Bauchspeicheldrüse an der offiziellen Warteliste vorbei verteilt worden.12 Bei einem Krisengespräch am 9. August 2012 zwischen der Bundesärztekammer (BÄK), der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und den Prüf- und Überwachungskommissionen von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen wurde zunächst abgewiegelt: Seit 1997 seien etwa 30.000 Organtransplantationen durchgeführt und darunter nur 20 Verdachtsfälle auf Fehlverhalten gemeldet worden. Es liege deshalb kein systemisches Versagen vor.13 Doch dann deckte die Frankfurter Rundschau am 25. August 2012 auf, dass es bei der Verteilung von Spenderorganen weitere Auffälligkeiten gegeben hatte: 9 von 10 Spenderherzen wurden demnach durch ein Verfahren an Organempfänger vergeben, das als manipulationsanfällig gilt. Das bestätigten Informationen aus der europäischen Organvermittlungsstelle Eurotransplant. Wurden noch 2001 nur 43,5 Prozent der Herzen an Patienten vergeben, die aufgrund akuter Lebensgefahr auf der Warteliste einen Hochdringlichkeitsstatus hatten, schnellte dieser Anteil bis zum Jahre 2011 auf 88,5 Prozent hoch. Chancen auf ein neues Herz hatte damit praktisch nur noch derjenige Patient, der diesen Status bekam. Die Kriterien dafür waren jedoch nicht einheitlich. Damit lag es weitgehend im Ermessen des behandelnden Arztes, wie er den Patienten einstufte.14 Nach einem zweiten Spitzentreffen mit Vertretern der Ärzte, der Krankenkassen, der Organspende-Stiftungen DSO und Eurotransplant sowie der Bundesländer kündigte der damalige Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (*1976) am 27. August 2012 an, man werde die Kontrolle und Aufsicht bei der Vergabe von Spenderorganen verbessern. Die zuständigen Stellen von Bund und Ländern würden personell so ausgestattet, dass sie diese Aufgabe wahrnehmen könnten. Mit Vertretern der Länder und der Organspende-Organisationen wurde verabredet, dass Landesbehörden verstärkt an Inspektionen in den Kliniken teilnehmen können. Die Entscheidung über die Vergabe von Organen solle weiterhin in erster Linie nach medizinischen Gesichtspunkten erfolgen.15 Es wurde offenkundig, dass die genannten Skandale in einem politisch äußerst ungünstigen Augenblick zutage traten, denn sie trugen nicht dazu bei, das Vertrauen der Bevölkerung in die Organspendepraxis zu erhöhen. Zwischen 2011 und 2015 fiel die Rate der postmortalen Organspender denn auch deutlich ab, nämlich von knapp 16 pro eine Million Einwohner (1.296 Spender im Jahre 2011) auf 10,8 pro eine Million Einwohner (877 Spender im Jahre 2015). Unter rein medizinischen Aspekten wären die Organe von zirka dreimal mehr Spendern transplantierbar.16 Wie wird eine Organtransplantation formal abgewickelt? Für die Organisation ist zunächst die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) in Frankfurt am Main zuständig. Die Vermittlung der Organe übernimmt die Stiftung Eurotransplant im niederländischen Leiden. Die operative Übertragung des Organs auf den Empfänger findet in den bundesweit rund 50 Transplantationszentren statt. Besteht bei einem Patienten der Verdacht auf den sogenannten Hirntod, vermittelt ein regionales DSO-Zentrum bei Bedarf unabhängige Neurologen für die Abklärung. Die Stiftung unterstützt die Ärzte außerdem bei der Klärung der Frage, ob der Patient einer Organspende zugestimmt hat oder ob seine Angehörigen dies tun. Dann werden die Daten des gespendeten Organs von der DSO an die Stiftung Eurotransplant übermittelt. Die Stiftung vermittelt gespendete Organe in 8 europäische Länder mit insgesamt 135 Millionen Einwohnern: Belgien, Deutschland, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Ungarn und Slowenien. Eurotransplant führt in ihren Wartelisten rund 15.000 Menschen. 2010 wurden im Zuständigkeitsbereich von Eurotransplant knapp 7.000 Lebern, Herzen, Lungen, Nieren und Bauspeicheldrüsen übertragen. Bei Eurotransplant laufen die Daten der Menschen, die auf eine Transplantation warten, und die Daten der gespendeten Organe zusammen. Die Informationen über die Wartenden kommen von den Transplantationszentren, die Daten über die Organe von der DSO. Die Ärzte sind in Deutschland an die Richtlinien für die Wartelistenführung der Bundesärztekammer gebunden. Danach ist eine Organtransplantation medizinisch geboten, wenn Erkrankungen nicht rückbildungsfähig fortschreiten oder durch einen genetischen Defekt bedingt sind und das Leben gefährden oder die Lebensqualität hochgradig einschränken. Weiter heißt es in den Richtlinien: Die Gründe für oder gegen die Aufnahme in die Warteliste sind von dem darüber entscheidenden Arzt zu dokumentieren. Entscheidend bei der Auswahl des geeigneten Empfängers sind die Dringlichkeit und die Erfolgsaussichten der Transplantation. Dafür wird aus Laborwerten ein Punktwert berechnet. Er ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit des erkrankten Menschen, ohne Transplantation innerhalb der nächsten drei Monate zu versterben. Abgesehen von den Fragen der gerechten Organzuteilung an die lebensbedrohlich erkrankten Menschen besteht das größte ethische Problem der Transplantationsmedizin jedoch in ihrer Fokussierung auf den Hirntod. Die damit verbundenen kritischen Fragen werden sowohl im Transplantationsgesetz als auch in der öffentlich lancierten Debatte meistens ausgeblendet: Handelt es sich beim Hirntod lediglich um den kompletten Funktionsausfall eines wichtigen, im Schädel gelegenen Organs, oder stirbt mit dem Gehirn auch der ganze Mensch? Theologisch gefragt: Verlässt die Seele den Leib in genau diesem Augenblick? Gerade im Hinblick auf das Thema Hirntod und Organspende schreibt unsere Gesellschaft der naturwissenschaftlichen Medizin jedoch eine erhebliche Entscheidungskompetenz zu, die einem Definitionsmonopol über das Ende des menschlichen Lebens gleichkommt. So führte der damalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer (*1949) in seiner Rede zum Entwurf des Transplantationsgesetzes am 25. Juni 1997 vor dem Deutschen Bundestag Folgendes aus: Die Definition des Todes ist keine Aufgabe der Politik oder des Gesetzgebers. Allein die naturwissenschaftliche Forschung kann für alle Menschen in gleicher Weise feststellen, welche körperlichen Befunde Leben und Tod voneinander abgrenzen, unabhängig von einem bestimmten Menschenbild oder einem subjektiven Verständnis von Leben und Tod. Das entspricht unserem Rechts- und Verfassungsverständnis. Denn auch das Bundesverfassungsgericht hat die Frage, wann menschliches Leben beginnt, nicht nach lebensweltlichen, theologischen, philosophischen oder emotionalen Erfahrungen beantwortet, sondern entsprechend dem naturwissenschaftlich-medizinischen Kenntnisstand. Für die Frage nach dem Lebensende kann es keine andere Entscheidungsgrundlage geben. Der Gesetzgeber kann in dieser wichtigen Frage keine unterschiedlichen Maßstäbe zugrunde legen.17 Damit sprach der Minister schon damals den ethisch wohl heikelsten Punkt im Zusammenhang mit dem Hirntodkonzept an: Der irreversible Ausfall der Gehirnfunktionen sollte als der Todeszeitpunkt des Menschen im anthropologischen und rechtlichen Sinne vor allem deshalb im Transplantationsgesetz festgeschrieben werden, damit die Ärzte im Fall einer Organentnahme nicht ihrerseits den Tod des Patienten verursachen müssten. Ein Gesetz, das den Hirntod hingegen als bloßes Entnahmekriterium juristisch verankern und damit offen lassen würde, ob der Mensch in diesem Zustand noch lebe oder schon tot sei, enthielte nach Seehofers Meinung aus drei Gründen unüberbrückbare Widersprüche und bedenkliche Grenzverschiebungen in der Frage des Lebensschutzes: Erstens: Wer offen lasse, ob der Organspender bei der Organentnahme noch lebt, der lasse auch offen, ob Ärzte mit der Organentnahme den Organspender töten. Damit stünde die Transplantationsmedizin in Deutschland rechtlich im Zwielicht und wäre auch international isoliert. Die Politik könne es den Ärzten nicht zumuten, bei einem angeblich Sterbenden durch die Entnahme eines lebenswichtigen Organs den Tod herbeizuführen. Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes auch tödlich für die gesellschaftliche Akzeptanz der Transplantationsmedizin. Die Bundesärztekammer als Vertreterin der deutschen Ärzteschaft und alle medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften hätten immer wieder deutlich gemacht, dass ein solches Verfahren für sie nicht zumutbar sei. Kein Transplantationsgesetz der Welt erlaube oder verlange, dass Ärzte die Organe sterbender Menschen zur Behandlung anderer schwerstkranker Menschen entnehmen. Zweitens: Erlaube der Gesetzgeber, Sterbenden lebenswichtige Organe im Interesse Dritter zu entnehmen, wäre nicht einzusehen, weshalb eine aktive Lebensbeendigung nicht auch sonst gesetzlich freigegeben werden sollte. Wer an der Unantastbarkeit des Lebens und an der Bindung der Ärzteschaft an diesen Grundsatz festhalten wolle, der dürfe hier keine Grenzverschiebung zulassen. Drittens: Wie sollte man den Bürgerinnen und Bürgern die Motivation zur Organspendebereitschaft erklären, wenn der Gesetzgeber in der Frage des Todes des Organspenders mehrdeutig sei und jeder Auslegung Raum lasse? Die gesellschaftliche Akzeptanz der Organentnahme wäre mit einem solchen Modell nachhaltig beeinträchtigt. An dieser Stelle sei das Augenmerk des Lesers auf die in ethischer Perspektive problematische Argumentationstechnik gelenkt, die das politische Statement des Ministers stützen sollte. Jene drei von ihm aufgeführten Gründe, die angeblich zugunsten des Hirntodkonzepts sprachen, benannten nämlich keine objektiven physiologischen Tatsachen, sondern sie beschrieben potenzielle sozial- und individualethische Gefahren, die eintreten könnten, wenn der Gesetzgeber vom Kriterium des Hirntodes als dem Todeszeitpunkt des Menschen abwiche: 1. Der Arzt würde den Patienten bei der Organentnahme töten; 2. die aktive Sterbehilfe könnte begünstigt werden; 3. die Bereitschaft zur Organspende in der Bevölkerung könnte abnehmen.18 Um die drei geschilderten Szenarien, die damals offenkundig unerwünscht waren und die auch heute noch unerwünscht wären, vermeiden zu können, musste der Hirntod zum rechtlich bindenden Todeskriterium des Menschen erklärt werden. In wissenschaftlicher und ethischer Hinsicht unseriös war und ist diese Argumentation aber gerade deshalb, weil sie zielorientiert vorgeht: Die Begründung des Hirntodkriteriums leitet sich nicht aus der Sache an sich, sondern aus den unerwünschten Folgen einer Zurückweisung dieses Kriteriums ab. Auf diese Weise wird aber einer funktionalen Indienstnahme des Hirntodkonzepts Vorschub geleistet, und es entsteht der Eindruck, der potenzielle Organspender solle dadurch, dass man ihn formal für tot erklärt, zu fremden Zwecken instrumentalisiert werden. Eine derartige Verzweckung wäre jedoch mit der Würde des Menschen nicht vereinbar. So entstand nicht ohne Grund der Eindruck, der Staat wolle schwer kranke und am Beginn des Sterbeprozesses stehende Menschen nur deshalb rechtlich für tot erklären, um ihnen Organe für Transplantationszwecke entnehmen zu können. Die daraufhin 1997 vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer formulierten und zuletzt 2015 aktualisierten Richtlinien zur Feststellung des (Hirn)todes sehen vor, dass durch die entsprechende Diagnostik nicht der Zeitpunkt des eintretenden, sondern der Zustand des bereits eingetretenen Todes festgestellt werde. Als Todeszeit wird die Uhrzeit registriert, zu der die Diagnose und Dokumentation des Hirntodes abgeschlossen sind.19 Eigentlich wäre der Hirntote nun also rechtlich eine Leiche. Aber noch niemand ist auf die Idee gekommen, einen solchen Menschen zu bestatten. Denn für ein Begräbnis ist der Hirntote längst nicht tot genug. Er atmet nämlich noch, wenngleich mithilfe von Maschinen. Zunächst müssen also die intensivmedizinischen Maßnahmen abgebrochen und die künstliche Beatmung beendet werden, damit der Hirntote nach einer Weile tatsächlich im konventionellen Sinne sterben kann. Und erst wenn der Tod des gesamten Organismus nach dem irreversiblen Herz- und Kreislaufstillstand eingetreten ist, kann die Bestattung des dann wirklich Verstorbenen erfolgen. Die Feststellung des Hirntodes bedeutet nach dem Transplantationsgesetz indessen nur, dass Großhirn, Kleinhirn und Stammhirn einen endgültigen, medizinisch nicht mehr behebbaren Funktionsausfall erlitten haben. An keiner Stelle aber steht im TPG ausdrücklich, dass der Hirntod mit dem Tod des Menschen identisch wäre. § 3 Absatz 1 Nr. 2 TPG legt lediglich fest, dass die Entnahme von Organen oder Geweben nur dann zulässig ist, wenn der Tod des Organ- oder Gewebespenders nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, festgestellt ist. Der Kölner Staatsrechtler Wolfram Höfling (*1954), seit 2012 Mitglied im Deutschen Ethikrat, bezeichnete diesen Umstand als ein Glanzstück juristischer Trickserei.20 Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am 19. August 2012 mitteilte, fanden inzwischen sogar einige Bundestagsabgeordnete, vorwiegend aus den Reihen der Grünen und der Linken, dass man im Parlament neu über den Hirntod diskutieren müsste. Die meisten ihrer Kollegen aber wollen nicht gerne darüber diskutieren. Denn was würde geschehen, wenn der Deutsche Bundestag am Ende feststellen müsste, dass Hirntote eben gerade nicht tot sind? Das wäre vermutlich das Ende eines Großteils der Transplantationsmedizin, da dann nur noch die sogenannte Lebendspende einer Niere oder eines Teils der Leber in Betracht käme. In einem im Juli 2012 veröffentlichten Interview mit dem damaligen Medizinischen Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) Prof. Dr. Günter Kirste (*1948) und dem Würzburger Betreuungsrichter Rainer Beckmann (*1961), der zugleich Lehrbeauftragter für Medizinrecht an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg ist, prallten die Gegensätze frontal aufeinander. Während der Transplantationschirurg Kirste davon ausging, der Hirntod sei als unumkehrbarer Funktionsausfall des gesamten Gehirns der Tod des Menschen, hielt der Jurist Beckmann dem entgegen, der Mensch sei erst dann tot, wenn alle wesentlichen Organe ihre Funktionsfähigkeit unwiederbringlich verloren hätten. Der Organtod des Gehirns allein reiche für die Todesfeststellung nicht aus. Beckmann wies auch darauf hin, dass die Organspende keine Bringschuld des Bürgers sei. Wir erlebten aber derzeit statt Information teilweise Propaganda. Dies gelte zum Beispiel für das Argument, täglich stürben drei Menschen, weil sie keine Organspende erhielten. Diese Menschen sterben aber nicht am Fehlen eines Spenderorgans, sondern an ihren Erkrankungen, so Beckmann.21 8. Sind Hirntote Tote oder Sterbende? In der politischen Diskussion über Organentnahme und Organtransplantation werden also wichtige Fakten ausgeblendet oder fehlerhaft dargestellt, die dem Ziel, die Bereitschaft zur Organspende zu erhöhen, widersprechen könnten. In der Fachwelt gibt es inzwischen massive Zweifel sowohl an der eindeutigen Diagnostizierbarkeit des Hirntodes wie auch an der Gleichsetzung von Hirntod und Tod. Dass diese Definition falsch ist, wird mittlerweile selbst von Wissenschaftlern zugegeben, die sie seinerzeit mit aufgestellt haben. Das erklärte am 21. März 2012 der Pädiatrische Neurologe und langjährige Verteidiger der Hirntoddefinition Alan Shewmon aus Los Angeles vor dem Deutschen Ethikrat. Shewmon stellte fest, dass sogenannte Hirntote noch längere Zeit leben können. So haben Frauen Monate nach Eintritt der mit Hirntod bezeichneten Situation Kinder geboren, Männer sind noch zeugungsfähig.22 Schon 2008 konzedierte der amerikanische Anästhesiologe und Medizinethiker Robert D. Truog von der Harvard-Universität gemeinsam mit seinem Kollegen Franklin Miller von den National Institutes of Health, die Praxis des Hirntod-Kriteriums habe tatsächlich die Tötung des Spenders zur Folge. Truog und Miller forderten aber gerade nicht als Konsequenz daraus, die derzeitige Praxis der Organentnahme zu beenden, sondern sie kamen zu dem ethisch wohl kaum widerspruchslos akzeptablen Schluss, dass die Regel, wonach der Spender tot zu sein habe, aufgegeben werden müsse: Die Tötung des Patienten durch Organentnahme solle künftig einfach als durch den guten Zweck der Organspende gerechtfertigt angesehen werden.23 Link zu Teil 2, einschließlich Literaturangaben und Anmerkungen. Der Autor (Foto) ist Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM). Von 2008 bis 2012 war er Mitglied im Deutschen Ethikrat. kath.net-Buchtipp Neuerscheinung Bestellmöglichkeiten bei unseren Partnern: Link zum kathShop Buchhandlung Christlicher Medienversand Christoph Hurnaus, Linz: Kein Tod auf Rezept - Warum Ärzte nicht töten sollen - Wichtiges Interview mit Prof. Axel W. Bauer Foto (c) Axel Bauer Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuOrganspende
|  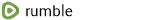  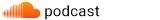 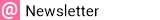 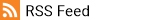  Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||


