 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Die 'Judensau' an Stadtkirche der Lutherstadt Wittenberg entfernen?31. August 2016 in Kommentar, 13 Lesermeinungen Pro und Kontra (idea): Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Stein des Anstoßes: die rund 700 Jahre alte Judensau an der Stadtkirche der Lutherstadt Wittenberg. Wetzlar (kath.net/idea) Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Stein des Anstoßes: die rund 700 Jahre alte Judensau an der Stadtkirche der Lutherstadt Wittenberg. Das Steinrelief zeigt eine Sau, an deren Zitzen Juden säugen. Dadurch sollten im Mittelalter Juden gedemütigt werden. In einer Petition fordern jüdisch-messianische und charismatische Kreise, die Judensau zu entfernen. Zwei Experten äußern sich dazu in einem Pro und Kontra für die Evangelische Nachrichtenagentur idea (Wetzlar). PRO Die sogenannte Judensau an der Wittenberger Stadtkirche soll aber bleiben. Sie predigt ihre antisemitische Botschaft seit mehr als 700 Jahren und ist damit ein gesamtkirchliches Problemerbe. Ähnliche und teils noch weitaus schlimmere Darstellungen inkl. sexueller Andeutungen gab und gibt es an anderen Sakralgebäuden in Europa, aber auffallend häufig in Deutschland. Das Prekäre an der Wittenberger Situation ist jedoch, dass sich Luther in einer seiner Schriften ausdrücklich positiv auf das Relief bezieht, dass Ende des 16. Jahrhunderts eine zusätzlich angebrachte Inschrift die Skulptur noch einmal bestätigte und dass spätestens ab 2017 alle Welt nach Wittenberg schauen wird. Es geht bei der Petition nicht um einen unreflektierten, schwärmerischen oder gar zerstörerischen Bildersturm wie gelegentlich in der Frühzeit der Reformation oder bei religiösen Extremisten heute. Es geht um eine fachgerechte Abnahme dieser und anderer Skulpturen und um eine sachgerechte Aufarbeitung anderorts. Das Relief verletzt und beschimpft Juden, also auch Jesus. Es beleidigt überdies den heiligsten Gottesnamen. Symbole sind nicht einfach neutral, von ihnen geht geistliche Realität aus. Eine Mahntafel allein reicht nicht aus. Deshalb bitten wir die Verantwortlichen, dass die Judensau entfernt wird und das ganze Thema historisch und theologisch (z.B. in einer Sammelgedenkstätte) aufgearbeitet wird. Der Autor, Pastor Henning Dobers (Hannoversch Münden), ist 1. Vorsitzender der (charismatisch orientierten) Geistlichen Gemeinde-Erneuerung in der Evangelischen Kirche (GGE). KONTRA Entscheidend ist, wie wir mit Geschichte umgehen. Daran vorbeigehen, beiseitelassen oder achtsam sein. Letzteres sind die Wittenberger, seitdem sie am 11. November 1988 an der Südwand der Stadtkirche eine Bodenplatte eingelassen haben mit Blickbeziehung zum oben an der Südostecke des Chores angebrachten Sandsteinrelief der Judensau. Das Mahnmal wurde von dem Bildhauer Wieland Schmiedel künstlerisch gestaltet; Trittplatten versuchen, etwas zu verdecken, doch es quillt hervor die Erinnerung: Sie lässt sich nicht unterdrücken. Herum läuft folgender Text: Gottes eigentlicher Name, der geschmähte Schem Ha Mphoras, den die Juden vor den Christen fast unsagbar heilig hielten, starb in sechs Millionen Juden unter einem Kreuzzeichen. Außerdem in hebräischer Schrift der Beginn des 130. Psalms: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Bei der Einweihung war auch die jüdische Gemeinde Magdeburg vertreten. Damit wir uns unserer Schuld bewusst bleiben Jede Stadtführung kommt daran vorbei, lädt die Gäste ein, nach oben zu schauen und den Text unten zu lesen. Aus Bild und Gegenbild entsteht ein Gesamtbild: Die Judensau lastet als Schuld auf uns; doch wir wissen um unsere Schuld und bekennen sie. Die Judensau zu entfernen, das wäre zu einfach. Das hieße: die Schuld unsichtbar zu machen, den Stachel im Fleisch einfach herausziehen. Die Wunde muss bleiben, damit wir uns unserer Schuld bewusst bleiben. Der Autor, Stefan Rhein (Lutherstadt Wittenberg), ist Vorstand und Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuAntisemitismus
| 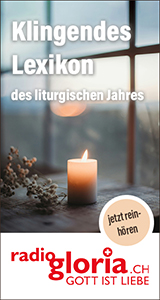      Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
