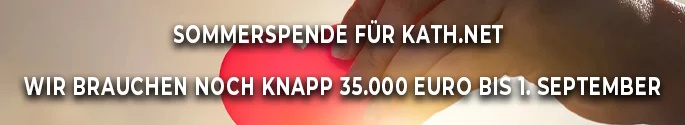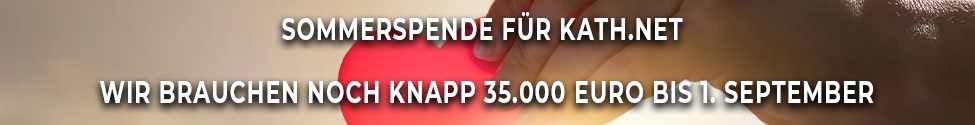 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
              
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Jenseits der Linien, im Gehege des Heiligen. Über einen Streit, der nicht sein darf15. Juli 2025 in Kommentar, 6 Lesermeinungen Die Liturgie als Ort der Anbetung – und als Bruchlinie der Gegenwart. Über das verborgene Drama zwischen Formen, Frieden und dem einen Opfer. Von Armin Schwibach Rom (kath.net/as) Die Versuchung unserer Zeit liegt in der Ordnung nach Lagern. Fortschrittlich - rückständig, offen - starr, reformorientiert - traditionsverhaftet. Diese Gegensätze sind allzu sauber, um wahr zu sein. Sie mögen politisch funktional sein – geistlich sind sie leer. Denn was in der Kirche zählt, ist nicht die Lage, sondern die Ausrichtung: coram Deo, vor Gott. Und dort lösen sich die künstlichen Gegensätze. Dort entscheidet sich, ob etwas aus der Wahrheit kommt - oder aus sich selbst. Joseph Ratzinger hat früh davor gewarnt, das Wesen der Kirche in soziologischen Begriffen zu fassen. Sie ist nicht Produkt geschichtlicher Dynamiken, sondern „Geheimnis, das aus der Eucharistie lebt“. Die Kategorien, mit denen wir heute kirchliche Wirklichkeit beschreiben, entspringen oft einer Perspektive, die das Heilige nicht mehr kennt. Wo aber das Mysterium in Verdacht gerät, wird die Liturgie zur Bühne, und der Glaube zur Meinung. Doch die Kirche lebt nicht aus Meinungen. Sie lebt aus dem Wort, das Fleisch geworden ist, und aus der Antwort darauf: aus Anbetung. „Non in commotione Dominus“ - nicht im Lärm ist der Herr, sondern in der Stille, in der Hingabe, im fiat der Jungfrau, das die Kirche in jeder Eucharistie nachspricht. Augustinus hat gesagt: „Veritas non est nostra, sed supra nos“ - Die Wahrheit gehört nicht uns, sie steht über uns. Diese Wahrheit hat einen Ort: Sie ist gegenwärtig im eucharistischen Herrn. Und so ist Liturgie - rechte Liturgie - nicht Ausdruck religiöser Kreativität, sondern Ausdruck des Empfangens. „Liturgie wird nicht gemacht“, sagt Ratzinger, „sie wächst aus dem lebendigen Glauben der Kirche“. Deshalb ist die sogenannte „alte Messe“ nicht einfach eine Form unter anderen, sondern ein gewachsener Raum des Gedächtnisses, ein geistlicher Leib, in dem die Kirche sich selbst erkennt - sub specie aeternitatis. Was an ihr berührt, ist nicht Ästhetik, sondern eine Tiefe, die sich dem Zugriff entzieht. Sie zwingt zur Ehrfurcht, nicht zur Kontrolle. Sie offenbart, was Thomas von Aquin die convenientia divinae sapientiae nennt - die „Angemessenheit der göttlichen Weisheit“. Nichts ist willkürlich, nichts ist zufällig. In allem leuchtet - wenn wir sehend werden - die Ordnung des Heiligen. Nicht wir sind die Herren dieses Raumes. Wir dürfen knien, hören, empfangen. Und eben dies wird heute oft als „rückständig“ markiert – weil wir verlernt haben, dass Wahrheit Bindung bedeutet. Dass Liebe immer auch Gehorsam meint - nicht als Zwang, sondern als freie Übereinstimmung mit dem, was größer ist als wir. Darum ist das eigentliche Problem nicht die Ablehnung eines bestimmten liturgischen Ritus, sondern die Schwächung des liturgischen Bewusstseins selbst. Die Polarisierung, wie sie heute in der Kirche zu beobachten ist, verkennt dies. Sie operiert mit kulturellen Rasterungen, wo geistliche Unterscheidung nötig wäre. Wer sich zur sogenannten traditionellen Liturgie hingezogen fühlt, wird nicht selten als ideologisch verdächtig gemacht, als ginge es um eine politische Rückkehr. Doch was viele in dieser Form suchen, ist nicht die Vergangenheit, sondern die bleibende Gegenwart Christi. Und sie tun es - oft wortlos, oft angegriffen – aus einer Sehnsucht, die tiefer reicht als Argumente. Ratzinger wusste um diese Spannung. Er sprach von einer Versöhnung mit der eigenen Geschichte, ohne Rückkehr zu bloßen Formen. Er suchte das „Gemeinsame, das tragfähig ist“, nicht durch Kompromiss, sondern durch Rückbindung: an das Ewige im Zeitlichen, an das Maß der Väter, an die Heiligkeit der Zeichen. Augustinus hat es so gesagt: „In laudibus Dei, totus sit homo“ - Beim Lob Gottes sei der ganze Mensch da. Nicht in Spaltung, nicht in Zerstreuung, sondern in Sammlung, in Einheit von Herz, Leib und Stimme. So wird es keine Heilung geben durch neue Lager, neue Schlagworte, neue Ordnungen. Sondern nur durch Rückkehr – zu Ihm, der veritas ist und via, der sich uns schenkt im Brot, das mehr ist als Zeichen: Gegenwart des Gekreuzigten, Fleisch gewordene Liebe. Hier, in der Liturgie, entscheidet sich alles. Nicht an der Oberfläche, sondern in der Tiefe. Nicht im Streit, sondern in der Anbetung. Und dort - ad orientem, auf Ihn hin - ist die Kirche eins. Oder sie ist gar nicht. In Zeiten der Verwirrung ist die traditionelle Liturgie nicht einfach nur eine Alternative: Sie ist ein Anker. Man verteidigt sie nicht, weil sie gefällt, sondern weil sie rettet. Denn, wie das Konzil von Trient sagt: In der Messe ist derselbe Christus enthalten und wird auf unblutige Weise dargebracht, der sich am Kreuz auf blutige Weise dargebracht hat (vgl. Denzinger-Hünermann 1743). Diese Wahrheit, die in jeder Falte des alten Ritus bewahrt wird, ist nicht nur eine Meinung unter vielen, sondern der Fels, dem die katholische Identität entspringt. Es ist die Messe, die die Heiligen hervorgebracht, die Theologie geprägt, die Kathedralen erbaut und die Dämonen besiegt hat. Sie ist das schlagende Herz der lebendigen Tradition, wo der Glaube niederkniet und sich nicht neu erfindet. Der heilige Leo der Große sagte es mit Nachdruck: „Quod in Christo visibile fuit, in sacramenta transivit” - Was in Christus sichtbar war, ist in die Sakramente übergegangen (Sermo 74,2). Und gerade in dieser sakramentalen Sichtbarkeit bewahrt die alte Liturgie das Fleisch des Wortes, seine Erniedrigung und seine Herrlichkeit. Der heilige Gregor der Große, der den Ordo der römischen Messe sammelte und weitergab, bezeugte, dass „die alte Regel der Väter noch immer in der Kirche gilt, wonach das Opfer in würdiger und reiner Weise dargebracht wird“ (vgl. Dialogi IV, 58). Für ihn war die Liturgie keine Archäologie, sondern die Bewahrung des lebendigen Geheimnisses. Wer sie heute mit Ehrfurcht berührt, berührt einen tiefen Nerv des mystischen Leibes. Und wer sie ehrt, nimmt – heute wie gestern – an jener lex orandi teil, die bereits lex credendi ist. In ihr spricht alles von Gott. Nichts lenkt ab, nichts trennt. Wo sie mit Ehrfurcht und Liebe gefeiert wird, ist die Kirche kein menschliches Experiment, sondern die Arche des Heiligen. Die Zukunft gehört denen, die das Feuer tragen können, nicht denen, die es löschen oder Glut ersticken.
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  Lesermeinungen
Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu |       Top-15meist-gelesen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||