 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Im Papst sind wir frei23. Juli 2022 in Kommentar, 22 Lesermeinungen Das Elend der Russisch-orthodoxen Kirche sollte den Verfechtern des «Synodalen Wegs» eine Warnung sein. Wer sich vom Papst trennt, gerät unter die Knute des Staates- Von Dr. Martin Grichting Chur (kath.net) Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat die Russisch-orthodoxe Kirche ins Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit gerückt. Ihr Elend, verkörpert im Patriarchen Kyrill, ist offensichtlich. Aber auch ihre Macht ist deutlich geworden. Denn sie legitimiert grossrussische Hegemonialphantasien und wird dafür staatlich massiv privilegiert. Der Preis, den die Staatskirche zahlt, ist jedoch hoch: Sie gibt ein Anti-Zeugnis für das Christsein, das man nur zutiefst bedauern kann. Es wird dem Christentum in Russland und darüber hinaus nachhaltigen Schaden zufügen. Aber welche Stütze bleibt einer Kirche, die ihre Bande zum Papst gelöst hat oder nie solche besessen hat? Es gehört zur Tragik der orthodoxen Christenheit, dass sie der jeweiligen staatlichen Gewalt und deren nationalistischen Launen ausgeliefert ist. Zeugnis dafür ist die nationale und kulturelle Fragmentierung der orthodoxen Kirchen, die schon eine innerorthodoxe Ökumene beinahe zum Phantom macht. Das sollte man in Deutschland und in der Schweiz bedenken, wenn man mit einem Instrument wie dem «Synodalen Weg» und seinem helvetisch-pragmatischen Imitat versucht, die Bande zum Papst und zur Universalkirche zu lockern. Die Fragestellung nach Elend und Macht der Staatskirchen sowie nach der Freiheit der Kirche ist nicht neu. Besonders interessant sind zwei diesbezügliche Stellungnahmen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, einer Zeit, als die kirchlichen Verhältnisse nach den Erschütterungen durch die Französische Revolution neu geordnet wurden. Es handelt sich um Denker, die von ihrem Herkommen verschieden sind: der französische Philosoph Alexis de Tocqueville (1805-1859) und der deutsche Theologe Johann Adam Möhler (1796-1838). Tocqueville betrachtete die Frage säkular, aus der Optik des Philosophen und Politikers, dem jedoch das Gedeihen der Religion stets ein Anliegen war. Als Liberaler war er zwar gegenüber dem Papst seiner Zeit, Pius IX., kritisch eingestellt. Denn dieser genoss eine Vormachtstellung, die Tocqueville als ungesund betrachtete. Erst das II. Vatikanische Konzil hat hierzu mit der vertieften Lehre über das Bischofsamt ein neues Gleichgewicht geschaffen. Die Kirche könne unterworfen werden, stellte Tocqueville im Jahr 1856 fest, wenn der Papst ein absoluter Herrscher werde, der direkt in allen Dingen befehle, auch gegenüber den lokalen Freiheiten der Gläubigen. Es gebe jedoch eine andere Form der Knechtschaft, die noch schlimmer sei. Sie bestehe darin, die Kirche derart in die Hand des Staates zu legen, dass sie dessen Herrschaftsinstrument werde, «wie es beispielsweise in Russland der Fall ist». Es gebe nichts Bedauerlicheres und Verachtenswerteres auf der Welt als diese Art der Knechtschaft. Wenn man einem Souverän zustimme, der das Joch Roms abschüttle, müsse man doch darauf achten, dass man die Priester, indem man sie vom Papst unabhängiger mache, nicht zu Knechten des Herrschers und dessen despotischen Willens degradiere. Man solle deshalb die Grenzen, die der Autorität des Papstes gesetzt würden, nicht Freiheit der Kirche nennen, wenn man an deren Stelle die Autorität des Königs setze. Und Tocqueville kam zum Schluss: «Wenn man wählen müsste zwischen diesen beiden Formen der Unterwerfung, muss ich gestehen, dass ich die Knechtung der Kirche unter ihrem geistlichen Oberhaupt, und in diesem Sinn die übertriebene Trennung der beiden Mächte, der Vereinigung dieser Mächte in den Händen eines weltlichen Despoten vorziehen würde». Der Tübinger Theologe Möhler kam in seiner Verteidigungsschrift über den Zölibat im Jahr 1828 ebenfalls auf das Papsttum zu sprechen. In einer vom Staatskirchentum der erstarkten deutschen Regionalfürsten geprägten Zeit erinnerte er daran, dass die Katholiken im Papst «noch kräftig sind». Erst kürzlich habe er für die Kirche «ehrenvolle Konkordate» erworben. Und Möhler erteilte nationalkirchlicher Staatshörigkeit eine klare Absage: «Versucht es, und lasst die Bischöfe mit den Regierungen in Unterhandlungen treten, ein Domkapitel, Seminarien und dergleichen zu dotieren, und seht den Erfolg! Mit den Bischöfen wird wie im Untertanen verfahren, der Papst aber geachtet als eine anerkannte, von allen Staaten unabhängige Macht. In ihm sind wir selbst noch frei». Der «Synodale Weg» in Deutschland und dessen abgewandelte Form in der Schweiz haben zum Ziel, die Kirche mainstreamkonform zu halten. Da sich die Gesellschaften in diesen Ländern aber immer mehr vom christlichen Glauben und dessen ethischen Folgerungen entfernen, kann die Kirche nur im Mainstream bleiben, indem sie sich von der kirchlichen Lehre und damit von der Universalkirche löst und nationaler wird. Die trübe Rolle, die der organisierte Deutschkatholizismus in der Abtreibungsfrage derzeit spielt, ist ein sprechendes Beispiel dafür. Die geistliche Einheit mit der Weltkirche wird dadurch immer mehr ersetzt durch die materielle Abhängigkeit vom Staat sowie einer noch zahlungsbereiten, aber zusehends säkularisierten «Kundschaft». Dies ist dann zwar kein Staatskirchentum einer Despotie, jedoch ein solches der postchristlichen Demokratie. Die Folgen sind vergleichbar. Es wäre hilfreich, wenn die Protagonisten nationalkirchlicher Selbstverzwergung einige Einsichten Tocquevilles meditieren würden: «Was die Staatsreligionen angeht, so war ich stets der Ansicht, dass sie, wenn sie auch manchmal der politischen Gewalt vorübergehend nützliche Dienste leisten können, der Kirche früher oder später immer zum Verhängnis werden». Denn: «Geht die Religion ein solches Bündnis ein, opfert sie um der Gegenwart willen die Zukunft. Und indem sie eine ihr nicht zukommende Macht erlangt, gefährdet sie ihre rechtmässige Gewalt» Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu | 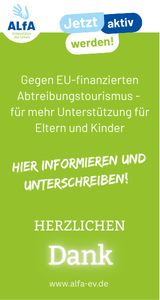       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
