 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  „Frauenweihe und Genderideologie: Eine Revolution gegen die Kirche“29. Dezember 2021 in Kommentar, 8 Lesermeinungen „In Deutschland ist es eine ausgemachte Sache, mittels des sogenannten ‚Synodalen Weges‘ die Frauenweihe ‚mit aller Macht‘ durchzusetzen; so formulierte es jüngst der scheidende ZdKPräsident.“ Gastbeitrag von Joachim Heimerl Wien (kath.net) Über die Jahrhunderte hinweg waren es die Frauen, die in wunderbarer Weise verdeutlicht haben, dass die Kirche vor allem eines ist, nämlich Mutter. Unzählige heilige Frauen legten davon ebenso Zeugnis ab wie die vier weiblichen Kirchenlehrerinnen und all jene Frauen, die bis heute in Familie, Alltag und Beruf den Glauben selbstverständlich leben. Ihre Stellung in der Kirche sahen sie durch die Muttergottes selbst geheiligt und hätten sie schon deshalb niemals als eine Herabsetzung verstanden. Im Gegenteil: Im selbstverständlichen Wissen darum, dass nur ein Mann der Sohn Gottes sein kann und dass ihn wiederum nur eine Frau auf die Welt bringen konnte, wären sie niemals auf die Idee gekommen, den absurden Vorstellungen des Genderwahns Gehör zu schenken. Und sie hätten noch weniger infolgedessen Gott, die Kirche und letztlich sich selbst in Frage gestellt. Die Zeiten haben sich indes geändert und in der Frauenfrage geht ein Riss durch die Kirche, wenigstens in Europa und – wie so oft – vor allem in Deutschland. Dort ist es eine ausgemachte Sache, mittels des sogenannten „Synodalen Weges“ die Frauenweihe „mit aller Macht“ durchzusetzen; so formulierte es jüngst der scheidende Präsident des „Zentralkomitees der Katholiken“. Wie man sich am Beginn der Französischen Revolution mit dem Ballhausschwur zusammenschloss, um vom französischen König eine Verfassung zu ertrotzen, so hat man sich in Deutschland zu einer „Kirchenrevolution“ versammelt. Offen bleibt dabei nur noch die Frage, welche Bischöfe sich dieser Revolution anschließen werden und welche – mit Gottes Hilfe – nicht. Damit ist die Frauenweihe zur „Gretchenfrage“ der Kirche in Deutschland geworden. In Goethes „Faust“ lautet diese Frage bekanntermaßen „Nun sag', wie hast du's mit der Religion?“ Und genau diese Frage muss sich jeder stellen lassen, der sich für die Frauenweihe einsetzt und der sich damit außerhalb des Glaubens der Kirche stellt. Erschreckend wird dabei eines deutlich: Indem man die Komplementarität der Geschlechter nicht mehr anerkennen, sondern sie einem starren Gleichheitswahn unterordnen will, hat man begonnen, sich gegen Gott, den Schöpfer, aufzulehnen. Aus der Rebellion gegen die Schöpfungsordnung ist konsequent eine Revolution gegen die Kirche geworden, die vom Motor der Genderideologie angetrieben wird. Unter der Prämisse vorgeblicher Ungleichbehandlung wird dabei das Charisma der Frauen tragisch verkannt: Solange Frauen nicht Priesterinnen werden könnten, behauptet man, seien sie in der Kirche nichts wert. Doch so schräg diese neue Form des Klerikalismus sein mag, so recht scheint einer Gender-Theologie jedes Mittel zu sein, mit dem sich das Frauenpriestertum und eine „geschlechtergerechte Kirche“ erstreiten lassen. Wie alle Revolutionen jedoch, so kennt auch diese Kirchenrevolte keine Vernunft und sie kennt auch keinen Glauben, außer den schalen Glauben an sich selbst. In der Forderung nach der Frauenweihe ist so ein theologischer Realitätsverlust ebenso eingetreten wie der Verlust des Katholischen. Da die Kirche von Christus her keine Vollmacht empfangen hat, Frauen die heiligen Weihen zu spenden, hat sie an dieser Wahrheit stets festgehalten. Weder der Papst noch ein Konzil könnten dies verändern, denn Päpste wie Konzilien sind nicht die „Macher“ der Wahrheit und sie sind auch nicht die Herren der Kirche. Über den Horizont, der ihnen von Christus her gesetzt ist, können sie nicht hinausgreifen. Die Vorstellung, man könnte mit revolutionären Forderungen beständigen Druck auf das kirchliche Lehramt ausüben, bis es schlussendlich nachgibt, ist demgegenüber allenfalls eine politische. Zugleich enthüllt diese Vorstellung aber auch das Zerrbild einer menschengemachten Kirche, deren Haupt nicht mehr Christus wäre, sondern ein Rätesystem kirchlicher Funktionäre. Dass man derlei in Deutschland bereits etablieren will, kann kaum überraschen. Mit dem, der von sich selbst mit dem Recht des einziges Sohnes vom Vater sagt „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh. 14, 6), hätte diese „Revolutionskirche“ dann allerdings nichts mehr zu tun. Doch so wenig Revolutionen dem Glauben und der Vernunft folgen, so wenig folgen sie der Wahrheit. Stattdessen erschaffen sie gewöhnlich eigene Wahrheiten und erkennen so wenig wie die Israeliten vor dem goldenen Kalb, dass diese nichts anderes als leere Trugbilder sind; sie bleiben menschliche Fiktionen. In Bezug auf die Durchsetzung der Frauenweihe wird dies an drei Beispielen deutlich: Das erste Beispiel ist im Grunde nur ein Trick aus dem Zauberkasten der Genderideologie: Man behauptet, Jesus Christus sei in erster Linie nicht Mann, sondern einfach Mensch geworden. Deshalb könnten eben auch Frauen in persona Christi handeln und die Priesterweihe empfangen. Was leichtfüßig und eingängig klingt, entbehrt jeder Logik: Da Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, kann er nicht Mensch werden, ohne Mann oder Frau zu sein. Hinzu kommt: Der Sohn (!) des ewigen Vaters konnte nur als Mann und eben nicht als Frau und damit als „Tochter Gottes“ zur Welt kommen. Folglich kann eben auch nur ein Mann Christus in persona repräsentieren. Eine Frau könnte dies dagegen ebenso wenig, wie ein Mann den Sohn Gottes gebären könnte. Gott hält sich an seine Schöpfungsordnung so, wie er sich an seine Verheißung hält: Denn wie sein Sohn nur als Mann zur Welt kommen konnte, so konnte dies nur im Volk der Juden geschehen. Weil das „Heil von den Juden“ (Joh. 4,22) kommt, konnte Jesus beispielsweise nicht als Ägypter, Grieche oder Römer geboren werden. Gott gerät zu sich selbst nicht in Widerspruch! Dagegen schraubt man auf dem „Synodalen Weg“ an der Fiktion eines absurden Gottes- und Menschenbildes herum, um nichts anderem gerecht zu werden, als dem Heidentum der Genderideologie. Zu dieser Vorgehensweise passt das zweite Beispiel. Wie jede Revolution, braucht auch die deutsche Kirchenrevolution eine griffige Ikone. Hier hat man sich rasch für die „Heilige Junia“ als – freilich fiktive – Kronzeugin für das Frauenpriestertum entschieden. Kurzerhand benannte allen voran der „katholische“ Frauenbund seine Verbandszeitschrift „Frau und Mutter“ in „Junia“ um, vollzog damit einen jähen Paradigmenwechsel und setzte zugleich ein klares antikirchliches Zeichen. Dass die vorgebliche „Junia“ in Wirklichkeit ein Mann war, der mit Paulus und Andronikus im Gefängnis saß und eben „Junias“ hieß (vgl. Röm. 16,7), wird schlichtweg als falsch behauptet: Ein jahrhundertelanger Übersetzungsfehler habe sich eingeschlichen, der – natürlich – nur ein Ziel gehabt haben soll: Die Vertuschung der angeblichen Wahrheit, dass eine Frau zu den Aposteln gehörte. Die Stoßrichtung dieser schwarzen Legende ist klar: Der Frauenweihe soll unter Berufung auf eine (gefälschte) Apostelgeschichte biblisch nichts mehr im Wege stehen. Dass Junias eine Frau gewesen sei, gibt der biblische Text in Wahrheit allerdings schlicht nicht her, ebenso wenig übrigens, dass Junias überhaupt zu den Aposteln gezählt hat. Das Deutungsprinzip solch biblischer Lektüre ist denkbar einfach: Wenn die Wahrheit nicht passt, wird sie passend gemacht. Der Stiftungswille Christi und die beständige Lehre der Kirche werden einer exegetischen Fiktion untergeordnet. Ebenso verhält es sich mit dem dritten Beispiel, nämlich mit der Behauptung, es habe in der frühen Kirche Diakoninnen gegeben, weshalb der Diakonat der Frau wieder eingeführt werden müsse. Dass diese „Wiedereinführung“ zum Steigbügelhalter der „Priesterinnenweihe“ würde, versteht sich dabei von selbst. Um der Sache größeren Nachdruck zu verleihen, hat der „katholische“ Frauenbund schon vor längerer Zeit einen „Tag der Diakonin“ eingeführt, den man mit „Wortgottesfeiern“ und pseudokirchlichem Gepräge alljährlich feierlich begeht. Zudem wurde in Rheinland-Pfalz jüngst ein Ausbildungskurs für künftige Diakoninnen eingerichtet, den der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz inzwischen mit größtem Wohlwollen besucht hat. Was man bei allem Aktionismus geflissentlich übersehen hat, ist allerdings die schlichte Tatsache, dass niemand etwas „wiedereinführen“ kann, was es nie gegeben hat. Zwar gilt es als unbestritten, dass es im syrischen Raum bis in die Spätantike tatsächlich „Diakoninnen“ gab. Unbestreitbar ist aber auch die Tatsache, dass diese Frauen nie die Diakonenweihe empfangen haben, sondern Laienhelferinnen der geweihten Diakone gewesen sind. Sie waren im griechischen Wortsinne „Diakoninnen“, das heißt „Dienerinnen“ der Gemeinde oder wie wir heute vielleicht sagen würden „Gemeindeschwestern“. Dementsprechend haben die Apostel, dem Stiftungswillen Christi verpflichtet und gebunden an den Heiligen Geist, ausschließlich Männern die Hände zur Diakonenweihe aufgelegt (vgl. Apg. 6, 3-6). Die angeblich „geweihten“ Diakoninnen der frühen Kirche sind dagegen abermals nicht als eine Fiktion. Derlei Fiktionen haben die Eigenschaft, dass sie sich selbst vermehren. So fällt der (natürlich inoffizielle) „Tag der Diakonin“ auf den liturgischen Gedenktag der Heiligen Katharina von Siena. Doch auch wenn man nicht einmal davor zurückschreckt, hier den Nimbus einer heiligen Kirchenlehrerin zu missbrauchen, kann dies kaum darüber hinwegtäuschen, dass Katharina selbst mit der Frauenweihe nichts zu tun. Und ebenso wie Katharina von Siena fallen alle vier Kirchenlehrerinnen als Ikonen einer feministischen Kirchenrevolution komplett aus. Der Grund dafür ist denkbar einfach: Hildegard von Bingen, Katharina von Siena, Teresa von Avila und Thérèse von Lisieux taugen zu nichts weniger als zu Schutzpatroninnen einer Gender-Theologie. Dafür sind sie trotz aller Kämpfe in ihrem Leben schlichtweg zu katholisch geblieben. Die große Botschaft, die sie jedoch an die Frauen in der Kirche zu richten haben, bleibt so leider von jenen ungehört, die starr auf das Frauenpriestertum pochen. Im Fall der Heiligen Thérèse von Lisieux (gest. 1897) ist dies ausgesprochen schade. Ungewöhnlich für eine Ordensfrau ihrer Zeit schreibt Thérèse in ihrer Autobiographie nämlich völlig offen, dass sie eine Berufung zum Missionar, zum Märtyrer und eben auch zum Priester verspüre: „Ich entdeckte in mir die Berufung zum Priester. Mit welcher Liebe, o Jesus, würde ich Dich in meinen Händen halten, wenn Du auf mein Wort hin vom Himmel herabsteigen würdest. Mit welcher Liebe würde ich Dich den Seelen reichen!“ Was Thérèse hier beschreibt, ist ihre ehrliche, eigene Empfindung, eine Sehnsucht, wie sie heute wohl auch andere Frauen verspüren. Thérèse aber setzt das, was sie sich wünscht, nicht absolut, sie stellt es nicht über die Gemeinschaft der Kirche und sie fordert es auch nicht für sich ein. Niemand kann das Priestertum für sich fordern, kein Mann und keine Frau, ganz gleich wie die eigenen Wünsche sind. Therese weiß das und sie nimmt es an, dies aber auch, ohne die eigene Empfindung zu verleugnen oder zu verbiegen. Sie schreibt: „Aber ach, bei all meinem Verlangen, Priester zu sein, bewundere ich die Demut des hl. Franz von Assisi und beneide ihn darum, und ich entdecke in mir die Berufung, ihn nachzuahmen, indem ich die erhabene Würde des Priestertums nicht annehme.“ Thérèse weiß um das Widersprüchliche, in dem sie steht. Sie weiß auch, dass es nicht von ihr abhängt, das Priestertum „anzunehmen“ oder nicht, aber sie lässt diese Widersprüchlichkeit stehen und flüchtet sich nicht in pseudo-theologische Fiktionen, die all dem abhelfen sollen. Sie bleibt „katholisch“, und ebenso wie Teresa von Avila bleibt sie so „eine Tochter der Kirche“. Das allein griffe hier jedoch zu kurz. Thérèse bleibt nämlich deshalb katholisch weil sie, wie in allen Prüfungen ihres Lebens, nah bei Jesus bleibt. Ihm vertraut sie sich an, bei ihm weiß sie sich, gerade was ihre Berufung betrifft, sicher und geborgen. Und genau deshalb kann ihr Jesus selbst zeigen, was ihre wirkliche Berufung ist. Sie schreibt: „O Jesus, meine Liebe, mein Leben... Wie sind diese Gegensätze miteinander zu vereinen? Wie sind die Wünsche meiner armen kleine Seele zu verwirklichen?“ Diese totale Hingabe an Jesus ist es, die der Gender-Theologie völlig fehlt. Thérèse geht einen anderen Weg, sie geht den Weg der Wahrheit und des Lebens, und weil sie auf diesem Weg geht, der Jesus selbst ist, schenkt Jesus ihr auch die tiefste Erkenntnis ihrer Berufung. Thérèse schreibt: „Bei der Betrachtung ließen mich meine Wünsche ein regelrechtes Martyrium erdulden. Auf der Suche nach einer Antwort öffnete ich die Briefe des Heiligen Paulus. Mein Blick fiel auf das XII. und XIII. Kapitel des ersten Briefes an die Korinther... In ersterem las ich, dass nicht alle Apostel, Propheten, Lehrer usw. sein können... dass die Kirche aus verschiedenen Gliedern zusammengesetzt ist und das Auge nicht gleichzeitig die Hand sein kann. (…) Ohne mich entmutigen zu lassen, setzte ich meine Lesung fort, und da brachte mir diese Stelle Linderung: Mit Eifer sucht die vollkommensten Gaben! (…) Dann erläutert der Apostel, wie all diese vollkommensten Gaben nichts sind ohne die Liebe... dass die Liebe der herausragende Weg ist, der zuverlässig zu Gott führt. Endlich hatte ich Ruhe gefunden. Als ich den mystischen Leib der Kirche betrachtete, hatte ich mich in keinem seiner Glieder wiedergefunden, wie sie der hl. Paulus beschreibt, oder besser gesagt, ich wollte mich in allen wiederfinden... Die selbstlose Liebe gab mir den Schlüssel zu meiner Berufung. Ich begriff, wenn die Kirche einen Leib hat, der aus verschiedenen Gliedern besteht, dann fehlt diesem Leib auch nicht das notwendigste, edelste von allen. Ich begriff, dass die Kirche ein Herz hat, und dieses Herz brennt vor Liebe. Ich begriff, allein die Liebe lässt die Glieder der Kirche wirken, und wenn die Liebe erlöschen würde, würden die Apostel nicht mehr das Evangelium verkünden und die Märtyrer sich weigern, ihr Blut zu vergießen... Ich begriff, die Liebe schließt alle Berufungen in sich ein, die Liebe ist alles, sie umfasst alle Zeiten und alle Orte... mit einem Wort, sie ist ewig!... Da rief ich in meiner überschäumenden Freude aus: O Jesus, meine Liebe.... Endlich habe ich meine Berufung gefunden. Meine Berufung ist die Liebe! Ja, ich habe meinen Platz gefunden, den Platz in der Kirche, und diesen Platz hast Du, mein Gott mir gegeben... Im Herzen der Kirche, meiner Mutter, werde ich die Liebe sein... so werde ich alles sein...so wird mein Traum Wirklichkeit werden.“ Natürlich könnte man einwenden, dass dies die sehr persönliche Erfahrung Thérèses ist und dass sie schon deshalb nicht zum Vorbild für die Frauen in der Kirche taugt, erst recht nicht in der Weihefrage. Was hier allerdings sehr wohl ein Vorbild ist, ist Thérèses Vorgehen. Thérèse geht nämlich nicht von sich selbst aus, sondern nur von Jesus. So bleibt sie bei ihm und bei seiner Kirche, die, wie sie selbst sagt, ja nichts anderes als sein mystischer Leib ist. Dadurch entsteht bei Thérèse keine gegenkirchliche Fiktion, sondern ein immer tieferes Vordringen zu jener Wahrheit, die Christus selber ist. Der Schlüssel dazu ist etwas, das die Gender-Theologie verleugnet: Es ist die „selbstlose Liebe“, die Liebe, die nicht auf sich selbst und die eigenen Wünsche hört, sondern die auf Jesus hinhört, auf das Wort der Heiligen Schrift, das er, das lebendige Wort, abermals selber ist. Thérèse hat zutiefst erkannt, dass das Priestertum nach einem Wort Johannes Pauls II. „Geschenk und Geheimnis“ ist und dass es schon deshalb den eigenen Wünschen und Vorstellungen entzogen bleibt. Christus selbst schenkt es, wem immer er will, und niemand kann es für sich fordern. Revolutionäre Umbrüche und fiktionale Konstrukte zeigen demgegenüber vor allem eins, nämlich wie weit sich diejenigen von Christus entfernt haben, die das Frauenpriestertum für sich fordern. Wo Verwirrung herrscht, der Geist des Widersprüchlichen und der Revolte, dort – so kann man sicher sein – herrscht niemals der Heilige Geist. Zum Wirken Gottes in seiner Kirche aber gehört es, dass er überall dort, wo Verwirrung entsteht, zugleich seinen Geist wirken lässt, jenen Geist, der Heilige und Propheten erweckt. Meist geschieht dies leise und unbemerkt, und es beginnt immer im Kleinen. Sicher ist es diesem Wirken des Geistes Gottes zu verdanken, dass sich inmitten der Verwirrungen der Kirche durch den „Synodalen Weg“ und die Forderung der Frauenweihe ausgerechnet in Deutschland eine anwachsende Gruppe junger Frauen gebildet hat, die an Christus festhält und die dem Beispiel Mariens folgen will. In Treue zur Kirche bringt „Maria 1.0“ das Charisma der Frau so neu zum Leuchten. Thérèse von Lisieux, die selbst eine junge Frau war und mit nur 24 Jahren starb, hätte an diesen Frauen ihre helle Freude gehabt. Es wäre der Kirche – zumal in Deutschland – zu wünschen, dass sie nicht auf die Fiktionen des Genderwahns hereinfällt, sondern dass sie von jenem Geist Gottes erfüllt würde, von dem „Maria 1.0“ in dieser Zeit ein hochherziges und prophetisches Zeugnis ablegt. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu | 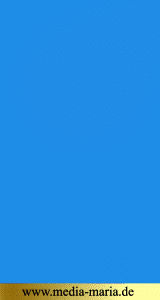  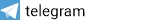 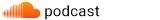 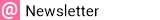 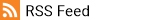  Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
