 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||||||||||
              
| ||||||||||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  "Social Egg Freezing": Ethikerin kritisiert VfGH-Entscheidung22. Oktober 2025 in Prolife, 1 Lesermeinung Österreich: Die Höchstrichter heben ausnahmsloses Verbot des Einfrierens von Eizellen ohne medizinischen Grund auf - IMABE-Direktorin Kummer warnt vor zu hohen Erwartungen und Risiken Wien (kath.net/KAP) Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat das ausnahmslose Verbot des Einfrierens von Eizellen ohne medizinischen Grund als unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig eingestuft. Ein möglicher gesellschaftlicher Druck auf Frauen sei kein ausreichender Grund für das Verbot, auch würden keine ethischen Probleme durch "Social Egg Freezing" entstehen, erklärte das Höchstgericht am Dienstag. Kritik an dieser Entscheidung äußerte Susanne Kummer, Direktorin des Instituts für Medizinische Anthropologie und Bioethik (IMABE). Damit werde nicht nur ein weiterer Schritt in Richtung eines vermeintlichen "Rechts auf ein Kind" gesetzt, sondern auch eine individualisierte Technik gesellschaftlich als Fortschritt verkauft, dessen medizinischer Nutzen nach wie vor gering sei. Die Richter verwiesen auf das Grundrecht auf Familien- und Privatleben und befanden, ethische Probleme beim Social Egg Freezing seien nicht hinreichend nachgewiesen; gesundheitliche Risiken könnten durch weniger einschneidende Mittel als ein Verbot gemindert werden. Dazu komme, dass die Hoffnungen auf spätere Mutterschaft durch die Medizin in vielen Fällen enttäuscht würden. Kontrolle, Planbarkeit und Freiheit durch das Einfrieren von Eizellen würden nur vorgegaukelt, denn die Technik sei in Wahrheit "suboptimal, weil kaum erfolgreich". Die Anbieter wüssten das auch selbst, doch wollten sie nicht um ihr lukratives Geschäft kommen. Frauen werde daher ein Verfahren als Freiheitsgewinn verkauft, obwohl die tatsächliche Erfolgswahrscheinlichkeit gering sei. Enttäuschte Erwartungen und Risiken Tatsächlich blieben die Erfolgsaussichten des Social Egg Freezing laut Kummer deutlich hinter den Erwartungen zurück. Nur rund elf Prozent der Frauen, die Eizellen vorsorglich einfrieren lassen, nutzen diese später tatsächlich für eine künstliche Befruchtung. Bei Frauen über 38 Jahren liegt die durchschnittliche Lebendgeburtenrate pro aufgetautem Eizellensatz lediglich bei fünf bis zehn Prozent. "Das Verfahren wird als Versicherung gegen die biologische Uhr vermarktet, doch es bleibt eine Hochrisikowette mit oft enttäuschendem Ausgang", so Kummer. Der Großteil der Frauen gehe am Ende trotz technischer Vorkehrungen ohne Kind nach Hause. Auch medizinisch sei das Verfahren nicht risikofrei. Für die Eizellentnahme müsse der weibliche Körper hormonell stark stimuliert werden, was unter anderem das potenziell lebensbedrohliche ovarielle Hyperstimulationssyndrom (OHSS) auslösen könne. Die Entnahme selbst sei ein invasiver Eingriff mit Narkose, Blutungs- und Infektionsrisiken. Weitere Komplikationen könnten bei späteren Schwangerschaften auftreten - insbesondere bei Frauen über 40, bei denen das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes, Bluthochdruck oder Frühgeburten deutlich erhöht sei. Studien zeigten zudem, dass rund ein Drittel der betroffenen Frauen ihre Entscheidung später bereue, insbesondere wenn die Belastungen höher oder die Erfolgswahrscheinlichkeit geringer seien als erwartet. "Internationale Studien zeigen, dass 33 Prozent der Frauen, die ihre Eizellen einfrieren ließen, diese Entscheidung später bereuen, 16 Prozent massiv." Gesellschaftsdebatte und flankierende Maßnahmen Das VfGH-Urteil gibt der Regierung bis April 2027 Zeit, eine neue Regelung zu erarbeiten, die Social Egg Freezing auch ohne medizinische Indikation legalisiert. Für Kummer ist entscheidend, dass diese Reform nicht isoliert erfolgt, sondern eingebettet wird in eine gesellschaftspolitische Debatte über Familie, Arbeitswelt und Vereinbarkeit. Technik allein sei nicht die Lösung für verzögerte Elternschaft, mahnte die Expertin. Statt das Problem auf die Einzelne zu verschieben, müsse eine kinder- und familienfreundliche Arbeits- und Lebenswelt geschaffen werden. "Wir brauchen keine technische Aufrüstung der Fortpflanzung und einer entsprechenden Industrie. Was wir brauchen, ist eine Gesellschaft, die Beziehungen fördert, Partnerschaften stärkt und Elternschaft willkommen heißt." Österreich stehe somit vor einer Gesetzesreform, bei der nicht nur technische Freiheit gewährleistet, sondern auch Verantwortung und Transparenz geschaffen werden müssten. Als dringend notwendig sieht Kummer flankierende Maßnahmen wie klare Beratungspflichten, die Beibehaltung der Altersgrenze von 40 Jahren für künstliche Befruchtung sowie eine realistische Einschätzung der Erfolgs- und Risikosituation durch systematische Datenerhebung zu den gesundheitlichen Auswirkungen für Frauen und Kinder. Auch das seit elf Jahren angekündigte zentrale Register für Spenderkinder müsse endlich umgesetzt werden, um Identität und Nachvollziehbarkeit zu sichern. Copyright 2025 Katholische Presseagentur KATHPRESS, Wien, Österreich Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  Lesermeinungen
Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuLebensschutz
| 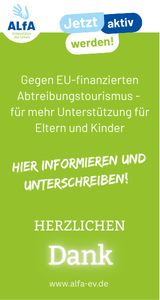       Top-15meist-gelesen
| |||||||||||
 | ||||||||||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||||||||||

