 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:   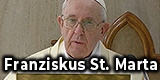  Top-15meist-diskutiert
|  Wir sollten besser dem Papst zuhören13. Juni 2010 in Interview, 5 Lesermeinungen Interview mit Weihbischof Marian Eleganti OSB Von Karin Landolt/Landbote. Winterthur (www.kath.net) Warum glauben die Menschen zumindest im Westen immer weniger an die Institution Kirche? Marian Eleganti: Institutionen haben es insgesamt schwerer in unserer stark individualisierten Gesellschaft. Viele wissen einfach nicht mehr um die Verdienste des Christentums für die Entwicklung unserer liberalen Gesellschaft. Religion und Glaube werden heute als reine Privatsache gesehen und vor allem individuell gelebt. Der Glaube soll das öffentliche Leben nicht mitgestalten. Gemeinschaft und gesellschaftlicher Gestaltungswille gehören aber zum Wesen der Kirche. Wenn das alles wegfällt und in die reine Privatheit gedrängt wird, wozu dann noch Mitglied einer Kirche sein? Sehen Sie in Ihrem Amt eine Möglichkeit, gegen den Mitgliederschwund und die abnehmende Loyalität etwas zu unternehmen? Das funktioniert nicht nach Programmen. Ausstrahlung ist gefragt, Überzeugungsarbeit, gute Argumente und Liebe. Die Zeugen des Evangeliums überzeugen, wenn Jesus tatsächlich durch sie wirken kann. Hier ist jeder, der Christus liebt, gefragt. Wir sind die Kirche und ihre beste Empfehlung. Offenbar gibt es christlich geprägte Menschen, die im Islam neuen Halt suchen (Konvertitinnen wie Nora Illi tragen ein Kopftuch oder sogar einen Ganzkörperschleier, der das Gesicht verdeckt). Was glauben Sie, finden diese Menschen, was sie im christlichen Glauben nicht finden? Eine starke, einfache Identität, eine Religion, die sich nicht ängstlich ins Private abdrängen lässt, sondern Teil des öffentlichen Lebens bleiben will; Gläubige, die Gott ernst nehmen und ihren Alltag ganz nach ihm ausrichten. Sie loben den Islam als Religion, die von vielen Gläubigen als bedeutender angesehen wird als der Staat, in dem sie leben? Kein Lob, sondern eine Erklärung. Ich versuche zu verstehen, warum viele Menschen sich davon angezogen fühlen mögen. Hat die Bischofskonferenz bezüglich der Missbrauchsfälle innerhalb der Kirche richtig reagiert? Die Bischofskonferenz hat sich nicht erst in den letzten Monaten dem Thema zugewandt. Ihre diesbezüglichen Richtlinien gehen schon auf das Jahr 2002 zurück und sind jetzt noch einmal optimiert worden. Es gibt seit über zehn Jahren unabhängige Opferhilfestellen und wirksame Präventionsarbeit. Die jetzt bekannt gewordenen Fälle sind fast alle 20 bis 50 Jahre alt. Es geht im Wesentlichen um Vergangenheitsbewältigung. Die Kirche musste sich aber den Vorwurf gefallen lassen, dass sie nur auf öffentlichen Druck reagierte, und während der Ostermesse in Rom wurde das Thema ausserdem von einem Kardinal als Geschwätz heruntergespielt. Was sagen Sie dazu? Der Kardinal bezog sich mit dem Wort Geschwätz gar nicht auf die Tatsache der Missbräuche, als wollte er diese leugnen oder herunterspielen, sondern seine Kritik betraf die angeblich persönlichen Versäumnisse des Papstes in dieser Frage. Papst Benedikt hat schon als Präfekt der Glaubenskongregation das Problem angepackt und 2003 aus diesem Grund den weltweit ersten internationalen Kongress über Pädophilie in Rom durchgeführt. Er verfolgt also schon lange eine konsequente und strenge Linie in dieser Frage und hat seine Ansichten in Sachen Pädophilie nicht erst in den letzten Monaten gebildet. Hat die Bischofskonferenz bezüglich der Missbrauchsfälle innerhalb der Kirche richtig reagiert, indem sie ab sofort nicht mehr dem Kirchen-, sondern dem weltlichen Strafrecht unterstehen sollen? Es geht hier vor allem um eine bessere Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat. Das Gespräch zwischen Kirche und Staat ist hilfreich und muss immer wieder optimiert werden. Staat und Kirche haben gemeinsame Anliegen. Zivilrechtliche Straftaten wie Pädophilie ziehen auch innerkirchliche Sanktionen nach sich. Das Tabuisieren, sprich Sexualität als Sünde zu sehen, führt offenbar zu grossen Problemen, nicht nur in der Kirche. Braucht die Kirche eine Reformation der Sexualmoral? Die Gleichung Sexualität = Sünde ist ein primitives Schema und falsch. Die Kirche hat nie solchen Unsinn gelehrt. Die Kirche hat eine sehr tiefe Auffassung von der menschlichen Sexualität. Sie basiert auf Treue, Würde der Person, Familie und soll Hingabe zum Ausdruck bringen. Das provoziert jene, welche die Sexualität wie ein Konsumgut behandeln. Eine Reform der Sexualmoral braucht meiner Meinung nach die Gesellschaft. Fragen Sie die Scheidungsrichter! Papstkritiker monieren, Rom blockiere die Ökumene, es fehle dem Vatikan am Willen für mehr Demokratie (Synodalität), und er setze sich zu wenig für Weltliches ein: zum Beispiel für den Frieden oder die Unterstützung der Familien. Kurz: Rom habe den Anschluss an die Gesellschaft, die Wissenschaft und die Kultur verloren. Was halten Sie von solchen Vorwürfen? Wir sollten uns weniger mit denen befassen, die über den Papst reden, als diesen selbst lesen und hören. Das Internet macht es möglich. Zu allen von Ihnen angesprochenen Themen finden Sie auf der Homepage des Vatikans und auf Radio Vatikan jede Menge Informationen. Alles andere ist eine Art Desinformation oder Polemik. Sie sagten in einem Interview, die Ursache für den Priestermangel sei der Glaubensschwund in den Familien. Warum tut sich die Kirche so schwer, den Zölibat zu hinterfragen? Die Frage des Zölibates wird seit dem Konzil ständig diskutiert. Sowohl das letzte Konzil wie auch die grossen Weltbischofssynoden, vor allem jene von 1971 und zuletzt jene vor fünf Jahren, haben sich immer wieder für die Beibehaltung des Zölibates ausgesprochen. Die Hinterfragung findet also statt, führt aber offensichtlich zu einem anderen Ergebnis, als viele sich wünschen. Auch jene Konfessionen, die den Zölibat nicht kennen, haben Nachwuchsprobleme, Mitgliederschwund und schlecht besuchte Gottesdienste. Die Ursachen des sogenannten Taufscheinchristentums liegen tiefer. Was verstehen Sie unter Taufscheinchristentum? Getaufte, die das kirchliche Leben nicht mehr mitmachen und oft kaum noch ein Glaubenswissen haben, das mit ihren Erfahrungen wachsen kann. Viele Mitglieder wünschen sich auch, dass Frauen, die heute als Pastoralassistentinnen bereits operativ gleiche Aufgaben wie Priester erfüllen, zu Priesterinnen geweiht werden. Warum sind die Frauen aber an höchster Stelle der Kirche nicht erwünscht? Die Frage hat komplexe theologische Hintergründe, die hier nicht ausgeführt werden können. Das bräuchte ein separates, längeres Interview. Hier nur dieser Aspekt: Es gibt Ideologien in Gesellschaft und Kirche, die in der Optik der Machtfrage stecken bleiben. Aber gerade vor dieser Optik hat Jesus gewarnt und seinen Jüngern und Jüngerinnen gesagt: Bei euch soll es nicht so sein. Das verstehe ich nicht ganz. Die Kirche hat zumindest in der Vergangenheit doch selbst ihre patriarchale Macht gegenüber dem unwissenden Volk ausgespielt, denken wir an den Ablasshandel, die Hexenverbrennungen, die Inquisition. Macht als Ideologie, etwa die reine Frage nach Machtstellungen, ist in jedem Fall abzulehnen. Aber sie kann natürlich trotzdem überall missbraucht werden, auch in der Kirche. Für die Schuld der Christenheit hat sich deswegen im Jahr 2000 Johannes Paul II. öffentlich entschuldigt. Viele Pfarrgemeinden organisieren sich, ohne viel Rücksicht auf die Direktiven von Rom zu nehmen. Ist es in der heutigen Zeit nicht sinnvoller, wenn sich die Gemeinden auch offiziell autonomer bewegen können? Die Gefahr ist, dass dabei ein sehr regionales, hermetisches Denken herauskommt, das je in progressiven wie konservativen Milieus kirchenspalterische Züge annehmen kann. Die betreffende Gruppe kennt die Grenzen der eigenen Optik und Wahrnehmung nicht mehr. Die Weltkirche denkt nicht helvetisch. Gemeindeautonomie ist kein kirchliches, sondern ein helvetisch-politisches Prinzip. Sie sagten Ende Jahr, das Amt des Weihbischofs zu übernehmen, sei für Sie ein Sprung ins kalte Wasser. Haben Sie mittlerweile schon Pflöcke eingeschlagen? Falls ja: welche? Die Frage kommt etwas zu früh. Bevor man Pflöcke einschlägt, muss man nachdenken. Auf folgende Fragen haben Sie bestimmt schon Antworten gefunden. Was bereitet Ihnen am meisten Freude? Was am meisten Sorgen? Es gibt Gottesdienste, da lächeln einem nachher alle freundlich entgegen und suchen die Begegnung. Das macht Freude. Sorgen bereitet mir, dass viele Menschen die Kirche ablehnen. Es wäre schön, wenn die Liebe zu ihr in ihnen neu erwachen würde. Interview: Karin Landolt © Landbote Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuSchweiz
|       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
