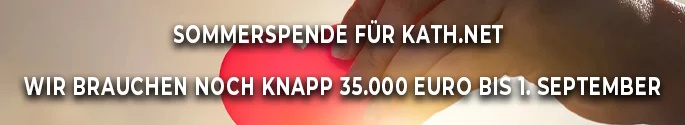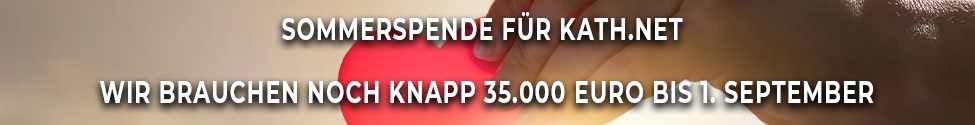 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||||||||||
              
| ||||||||||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Carl Lampert: Für die Nazis 'der gefährlichste Mann im Klerus'4. November 2011 in Chronik, 1 Lesermeinung Der Innsbrucker Provikar bezahlte sein mutiges Eintreten gegen die kirchenfeindlichen Handlungen des NS-Regimes mit dem Tod Innsbruck-Feldkirch (kath.net/KAP) Der ranghöchste österreichische Priester, den die Nationalsozialisten ermordeten, wird am 13. November als Märtyrer seliggesprochen. Österreichs neuer Seliger, Carl Lampert, ist Vorarlberger. Die Seligsprechungsfeier unter Leitung von Kardinal Angelo Amato findet deshalb in Dornbirn statt. Lampert wurde am 9. Jänner 1894 in Göfis als jüngstes von sieben Kindern geboren. Er studierte Theologie am Fürstbischöflichen Seminar in Brixen, wo ihn Bischof Franz Egger 1918 auch zum Priester weihte. Nach zwölf Jahren als Kaplan in Dornbirn-Markt ging Lampert 1930 zum Kirchenrechtsstudium nach Rom. Er wohnte im Kolleg der "Anima"; Rektor des Kollegs war damals der wegen seines Eintretens für den Brückenschlag zum Nationalsozialismus höchst umstrittene Österreicher Alois Hudal. Lampert war neben seinem Studium an der Gregoriana, das er 1935 als Rota-Advocatus abschloss, auch als Sekretär des römischen Büros der deutschen und österreichischen Diözesen ("Agentie") tätig. 1935 übernahm Lampert den Aufbau des kirchlichen Gerichts in der damaligen Apostolischen Administratur Innsbruck-Feldkirch, bevor er am 15. Jänner 1939 zum Innsbrucker Provikar ernannt wurde. Als Stellvertreter von Bischof Paulus Rusch war Lampert damit für die kirchliche Verwaltung des Tiroler Teils der Apostolischen Administratur verantwortlich. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten sah sich auch die katholische Kirche in Tirol und Vorarlberg repressiven Maßnahmen ausgesetzt. Beleg dafür ist etwa eine Aussage des Innsbrucker Gestapo-Chefs Werner Hilliges, der 1945 erklärte: "Da es in Tirol und Vorarlberg keinerlei nennenswerte kommunistische oder marxistische Gegner und auch keine Judenfrage gab, blieb als einziger politischer Gegner der römisch-katholische Klerus und sein überaus starker Einfluss auf die Bevölkerung übrig." Provikar Lampert protestierte bei der Gestapo, wenn Priester und Ordensleute eingesperrt wurden, und versuchte sie wieder frei zu bekommen. NS-Gauleiter Franz Hofer wollte Tirol als ersten "klosterfreien Gau" sehen. Als im März 1940 das Innsbrucker Kloster der Ewigen Anbetung enteignet werden sollte, wehrten sich die Ordensfrauen. Provikar Lampert stellte sich auf die Seite der Schwestern und übergab der Gestapo ein Protestschreiben, woraufhin er zum ersten Mal für zehn Tage in Haft genommen wurde. Rund eine Woche danach - am Ostersonntag, dem 23. März 1940 - berichtete "Radio Vatikan" von den Maßnahmen der Gestapo gegen die katholische Kirche in Tirol. Die Gestapo machte Lampert für die Radioberichte verantwortlich, und der Provikar wurde erneut zwei Wochen lang inhaftiert. Einsatz für Otto Neururer Entscheidend für das Schicksal Lamperts war schließlich sein Eintreten für Otto Neururer. Der 1996 seliggesprochene Pfarrer von Götzens wurde 1940 im Konzentrationslager Buchenwald - unter grausamsten Folterungen und an den Füßen aufgehängt - ermordet. Lampert feierte einen Trauergottesdienst und übernahm Verantwortung für die Todesanzeige, in der trotz Verbots öffentlich vermerkt war, dass Neururer "nach großem Leid" (eine Anspielung auf die Folterungen) sowie "fern seiner Seelsorgegemeinde, in Weimar/Buchenwald" (ein Hinweis auf das KZ als Todesort) gestorben sei. Weil ihn die Nationalsozialisten als "gefährlichsten Mann innerhalb des Klerus" identifiziert hatten, begann für Provikar Lampert im Juli 1940 das Martyrium. Er verbrachte ein Jahr in den beiden Konzentrationslagern Dachau und Sachsenhausen-Oranienburg sowie in drei Gefängnissen von Gestapo und Wehrmacht. Danach wurde Lampert - "abgemagert und von Schwerstarbeit gekennzeichnet", wie sich der Tiroler Altbischof Reinhold Stecher erinnert - zwar freigelassen, aber "gauverwiesen". Sein Verbannungsort war Stettin an der Ostsee. Der Berliner Bischof Konrad von Preysing brachte ihn im dortigen Carolusstift unter, wo Lampert predigte und Glaubensstunden für Jugendliche abhielt. Angebliche Spionage-Affäre Während der seelsorgerlichen Reisen durch die Region, bei denen Lampert u.a. Gottesdienste mit katholischen Zwangsarbeitern feierte, begleitete den Priester der Gestapo-Spitzel Franz Pissaritsch. Unter dem Decknamen "Ingenieur Hagen" versuchte er den Provikar durch die Weitergabe gefälschter Informationen über eine geheime deutsche Vergeltungswaffen zur Spionagetätigkeit anzustiften. Carl Lampert lehnte dies ab, zeigte den Mann aber auch nicht an. Auf Basis der Aufzeichnungen des Spitzels wurde der Provikar in eine angebliche Spionage-Affäre verwickelt und gemeinsam mit Mitgliedern des "Stettiner Priesterkreises" im Februar 1943 verhaftet und bei Verhören schwer misshandelt. Die Gestapo warf Lampert neben der angeblichen Spionage, Meinungsäußerungen über die Verschleppung von Juden und die Ermordung von Patienten aus sogenannten "Heilanstalten" sowie das Abhören ausländischer Sender und die Begünstigung von Zwangsarbeitern vor. Am 20. Dezember 1943 sprach die NS-Justiz das erste Todesurteil aus. Nach einer zweiten Verurteilung durch ein Reichskriegsgericht im September 1944 wurde Provikar Lampert am 13. November 1944 um 16 Uhr in Halle an der Saale gemeinsam mit dem Kaplan Herbert Simoneit und Carl Lampert ist der ranghöchste österreichische Priester, den die Nationalsozialisten ermordet haben. Vier Jahre nach der Hinrichtung wurde seine Urne nach Vorarlberg gebracht. Sie ist heute in der Pfarrkirche seines Heimatortes Göfis beigesetzt. 1998 leitete der damalige Feldkircher Bischof Klaus Küng den Seligsprechungsprozess für den Vorarlberger Priester ein. Papst Benedikt XVI. bestätigte am 27. Juni 2011 das Martyrium. Benedikt XVI. gab in dem Dekret von 27. Juni auch seine Zustimmung zur Seligsprechung der Ordensgründerin Hildegard Burjan (1883-1933). Burjan wird am 29. Jänner 2012 im Wiener Stephansdom seliggesprochen. Copyright 2011 Katholische Presseagentur, Wien, Österreich Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  Lesermeinungen
Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuSeligsprechung
| 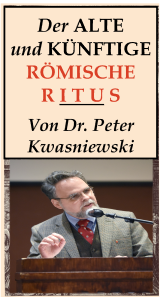      Top-15meist-gelesen
| |||||||||||
 | ||||||||||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||||||||||