 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  "Statt den Geruch der Schafe anzunehmen, schlägt der Hirte hier mit seinem Stab kräftig auf sie ein"19. Juli 2021 in Kommentar, 31 Lesermeinungen Zum Motu proprio Traditionis custodes. Ein Kommentar von Kardinal Gerhard Ludwig Müller Vatikan (kath.net/The Catholic Thing) Die Absicht dieses Motu proprio ist es, die Einheit der Kirche zu sichern oder wiederherzustellen. Als Mittel dazu dient die totale Vereinheitlichung des Ritus Romanus in der Form des Missale von Paul VI. (inklusive seiner bisherigen Variationen). Deswegen wird die Messfeier in der außerordentlichen Form des römischen Ritus, wie sie Papst Benedikt XVI. mit Summorum pontificum (2007) auf der Basis des Missale von Pius V. (1570) bis Johannes XXIII. (1962) einführte, drastisch eingeschränkt. Die erkennbare Absicht ist es, sie auf die Dauer zum Aussterben zu verurteilen. Im "Brief an die Bischöfe der ganzen Welt" versucht Papst Franziskus die Motive darzulegen, die ihn als den Träger der obersten Autorität der Kirche bewegt haben, die Liturgie im außerordentlichen Ritus zu unterdrücken. Über die Darlegung subjektiver Impulse hinaus wäre aber auch eine stringente und logisch nachvollziehbare theologische Argumentation angezeigt gewesen. Denn die päpstliche Autorität besteht nicht vordergründig darin, von den Gläubigen einen Gehorsam formaler Unterwerfung des Willens zu verlangen, sondern viel wesentlicher darin, ihnen auch eine überzeugte Zustimmung des Verstandes zu ermöglichen. Schon Paulus war so höflich mit seinen oft so widerspenstigen Korinthern, dass er sagte. "Doch vor der Kirche will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, um andere zu unterweisen, als zehntausend Worte in Zungen." (1 Kor 14, 19). Dieser Zwiespalt zwischen guter Intention und mangelnder Ausführung entsteht immer dort, wo die Einwände kompetenter Mitarbeiter als Obstruktion der Absichten ihres Vorgesetzten empfunden und deswegen in weiser Voraussicht gleich ganz unterlassen werden. So erfreulich dieses mal die Berufung auf das II. Vatikanum ist, so ist doch auf eine exakte und kontextgerechte Verwendung seiner Aussagen zu achten. Das fälschlich Lumen gentium 21 zugeschriebene Zitat des hl. Augustinus von der Zugehörigkeit der Kirche "dem Leibe" und "dem Herzen nach" (Lumen gentium 14) bezieht sich auf die volle Kirchengliedschaft des Katholiken. Sie besteht in der sichtbaren Eingliederung in den Leib Christi (Glaubensbekenntnis, sakramentale und kirchlich-hierarchische Gemeinschaft) und die Zugehörigkeit dem Herzen nach, d.h. im Heiligen Geist. Gemeint ist aber nicht der Gehorsam gegenüber dem Papst und den Bischöfen in der Sakramenten-Disziplin, sondern die heiligmachende Gnade, die uns voll in die unsichtbare Kirche als Lebensgemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott einbezieht. Denn die Einheit im Bekenntnis des geoffenbarten Glauben und der Feier der Mysterien der Gnade in den sieben Sakramenten verlangt keineswegs eine sterile Einheitlichkeit in der äußeren liturgischen Gestalt nach dem Vorbild immer gleicher Filialen der internationalen Hotelketten. Die Einheit der Gläubigen untereinander wurzelt in der Einheit in Gott kraft Glaube, Hoffnung und Liebe und hat nichts zu tun mit einer Uniformierung im Aussehen, dem Gleichschritt einer Militärformation und der Gleichschaltung des Denkens im Big-Tech-Zeitalter Es hat auch nach dem Konzil von Trient immer ein gewisse (musikalische, zelebrative, regionale) Vielfalt in der liturgischen Gestaltung der Meßfeiern gegeben. Die Intention des Papstes Pius V. war es nicht, die Vielfalt der Riten, sondern die Mißstände zu unterdrücken, die bei den protestantischen Reformatoren zu einem verheerenden Unverständnis gegenüber der Substanz des Messopfers geführt hatten (Opfercharakter und Realpräsenz). Im Missale von Paul VI. wird eine ritualistische (rubrizistische) Homogenisierung aufgebrochen, gerade um einen mechanischen Vollzug zu überwinden zugunsten einer inneren und äußeren aktiven Teilnahme aller Gläubigen jeweils in ihrer Sprache und Kultur. Die Einheit des lateinischen Ritus sollte aber erhalten bleiben durch die gleiche liturgische Grundgestalt und die präzise Orientierung der Übersetzungen am lateinischen Original. Das ist deshalb eine Verantwortung an der Einheit im Kult, welche die römische Kirche nicht auf die Bischofskonferenzen abwälzen darf. Eine Übersetzung der normativen Texte des Missale von Paul VI. oder gar der biblischen Texte, die den Inhalt des Glaubens verdunkelt oder sich gar anmaßt, die verba Domini (z.B. "pro multis" bei der Konsekration, das "et ne nos inducas in tentationem" im Pater noster) zu verbessern, widerspricht mehr der Wahrheit des Glaubens und der Einheit der Kirche als die Feier der Messe nach dem Missale Johannes XXIII. Der Schlüssel zu einem katholischen Verständnis der Liturgie liegt doch in der Einsicht, dass die Substanz der Sakramente als von Christus eingesetzter sichtbarer Zeichen und Mittel der unsichtbaren Gnade der Kirche kraft göttlichen Rechtes vorgegeben ist, dass es aber dem Apostolischen Stuhl und nach Maßgabe des Rechts den Bischöfen zukommt, die äußere Gestalt der Liturgie (soweit sie nicht schon seit apostolischer Zeit existiert) zu ordnen. (Sacrosanctum concilium 22 § 1). Wenn der Papst in Traditionis Custodes gegenüber den Traditionalisten zu Recht auf die vorbehaltlose Anerkennung des II. Vatikanums pocht, dann darf auch im Annuario Pontificio (2021) die Lehre des II. Vatikanums, dass der Römische Bischof "der Nachfolger Petri, der Stellvertreter Christi und das sichtbare Haupt der ganzen Kirche ist" (LG 18), nicht unter der Überschrift "Historische Titel" als scheinbare Bescheidenheit verkauft, d.h. aber (in einem unbedarften Historismus) dogmatisch verunklärt werden. Die Bestimmungen des Motu proprio Traditionis custodes sind disziplinärer, nicht dogmatischer Natur und können von jedem künftigen Papst auch wieder modifiziert werden. Der Papst ist aber in seiner Sorge um die Einheit der Kirche im geoffenbarten Glauben voll zuzustimmen, wenn die Feier der Hl. Messe nach dem Missale von 1962 als Ausdruck der Resistenz gegen die Autorität des II. Vatikanums sowohl in der Glaubens- und Sittenlehre als auch in der liturgischen und pastoralen Ordnung relativiert oder sogar geleugnet wird. Katholisch kann sich keiner nennen, der entweder hinter das II. Vatikanum (oder sonst eines der vom Papst anerkannten Konzilien) als Zeit der "wahren Kirche" zurück will oder es als eine Zwischenstufe zu einer "neuen Kirche" hinter sich lassen möchte. Man wird den Willen des Papstes Franziskus, die abschätzig sogenannten "Traditionalisten" über das Missale Pauls VI. zur Einheit zurückzuführen, sehr wohl messen an seiner Entschiedenheit, mit der er die unzähligen bis zur Blasphemie reichenden "progressistischen" Missbräuche in der gemäß dem II. Vatikanum erneuerten Liturgie abstellt. Die Paganisierung der katholischen Liturgie, die im Wesen nichts anderes ist als die Anbetung des einen und dreifaltigen Gottes ist, durch die Mythologisierung der Natur, die Vergötzung der Umwelt und des Klimas sowie das Pachamama-Spektakel waren für die Wiederherstellung und Erneuerung einer würdigen und rechtgläubigen Liturgie katholischen Glaubens eher kontraproduktiv. Niemand kann doch vor der Tatsache die Augen verschließen, dass sogar schon diejenigen Priester und Laien, die nach der Ordnung des Missale Pauls VI. die hl. Messe feiern, weithin als traditionalistisch verschrien werden. Die Lehren des II. Vatikanums über die Einzigkeit der Erlösung in Christus, die volle Verwirklichung der Kirche Christi in der katholischen Kirche, das innere Wesen der katholischen Liturgie als Anbetung Gottes und Vermittlung der Gnade, die Offenbarung und ihre Gegenwart in Heiliger Schrift und Apostolischer Tradition, die Unfehlbarkeit des Lehramtes, der Primat des Papstes, die Sakramentalität der Kirche, die Würde des Priesteramtes, die Heiligkeit und Unauflöslichkeit der Ehe werden von einer Mehrheit der deutschen Bischöfe und Laienfunktionäre in offenem Gegensatz gerade zum II. Vatikanum häretisch geleugnet (wenn auch mit pastoralen Floskeln kaschiert). Und bei aller zur Schau getragenen Papst-Franziskus-Begeisterung wird die ihm als Nachfolger Petri von Christus übertragene Autorität übergangen. Die Lehräußerung der Glaubenskongregation über die Unmöglichkeit, gleichgeschlechtliche und außereheliche Sexualkontakte im Widerspruch zum Willen Gottes durch einen Segen zu legitimieren wird von Bischöfen, Priestern und Theologen als eine Sondermeinung minderbemittelter Kurialer lächerlich gemacht. Hier haben wir eine Bedrohung der Einheit der Kirche im geoffenbarten Glauben, die an die Ausmaße der protestantischen Abspaltung von Rom im 16. Jahrhundert denken lässt. Angesichts der Disproportion im Engagement gegen die massiven Angriffe auf die Einheit der Kirche im deutsch-synodalen Weg (und bei sonstigen Pseudo-Reformern) und der harschen Disziplinierung der altrituellen Minderheit drängt sich das Bild von der Feuerwehr auf, die statt des lichterloh brennenden Hauses zuerst die kleine Scheune daneben rettet. Ohne die geringste Empathie geht man hinweg über die religiösen Empfindungen der – oft auch jugendlichen Teilnehmer – an den Messen nach dem Missale Johannes XXIII. (1962). Statt den Geruch der Schafe annehmen, schlägt hier der Hirte hier mit seinem Stab kräftig auf sie ein. Was eine besondere Aufmerksamkeit in Traditionis custodes verdient, ist die Verwendung des Axioms "lex orandi-lex credendi". Es ging im 8. Kapitel des antipelagianischen "Indiculus" um "die Sakramente der priesterlichen Gebete, die von den Aposteln überliefert, auf der ganzen Welt und in der ganzen katholischen Kirche einheitlich gefeiert werden, damit die Regel des Betens die Regel des Glaubens sei." (DH 246). Damit ist die Substanz der Sakramente (in Zeichen und Worten) gemeint aber nicht der liturgische Ritus, von denen es auch in der patristischen Zeit mehrere gab (mit jeweiligen Varianten). Man kann also nicht schlichtweg das jeweils letzte Missale für die einzig gültige Norm des katholischen Glaubens erklären ohne zu unterscheiden zwischen dem "kraft göttlicher Einsetzung unveränderlichem Teil und den Teilen, die dem Wandel unterworfen sind." (Sacrosanctum concilium 21). Denn die jeweils sich wandelnden liturgischen Riten stellen nicht jeweils einen andern Glauben dar, sondern bezeugen den einen und selben Apostolischen Glauben der Kirche in seinen unterschiedlichen Ausdrucksweisen. Das bestätigt der Papst, dass er die Feier nach der älteren Ritus-Form unter bestimmten Bedingungen zulässt. Zu Recht weist Papst Franziskus auf den auch in dem neueren Missale zentralen Römischen Kanon als Herzstück des Römischen Ritus hin. Dieser verbürgt die ins Auge springende Kontinuität der römischen Liturgie in ihrem Wesen und ihrer organischen Entwicklung und inneren Einheit. Man muss ohne Zweifel von den Liebhabern der alten Liturgie die Anerkennung der erneuerten Liturgie-Gestalt erwarten wie ebenso die Anhänger des Missale Pauls VI. auch bekennen müssen, dass die Messe nach dem Missale von Johannes XXIII. eine wahre und gültige katholische Liturgie ist, also die Substanz der von Christus eingesetzten Eucharistie enthält und es somit nur "die eine Messe aller Zeiten" gibt und geben kann. Ein wenig mehr Kenntnis in der katholischen Dogmatik und der Liturgie-Geschichte könnte der unglückseligen Parteibildung entgegenwirken und auch die Bischöfe vor der Versuchung bewahren, autoritär, lieblos und borniert gegen die Anhänger der "alten" Messe vorzugehen. Die Bischöfe sind vom Heiligen Geist als Hirten eingesetzt (Apg 20, 28) und nicht die Außenvertreter einer Zentrale mit Aufstiegschancen. Den guten Hirten erkennt man daran, dass er sich lieber um das Heil der Seelen sorgt als sich mit servilem Wohlverhalten an höherer Stelle selbst zu empfehlen (1 Petr 5, 1-4). Man kann nicht, wenigstens solange noch das Widerspruchsprinzip gilt, zugleich den Karrierismus geißeln und die Karrieristen befördern. Es bleibt zu hoffen, dass die Kongregationen für die Religiosen und für den Gottesdienst mit der neuen Kompetenz nicht einem Machtrausch verfallen und meinen, einen Zerstörungsfeldzug führen zu müssen gegen die Gemeinschaften des alten Ritus -in der törichten Meinung, der Kirche einen Gefallen zu tun und das II. Vatikanum zu fördern. Wenn Traditionis custodes der Einheit der Kirche dienen soll, dann kann nur jene Einheit im Glauben gemeint sein, die uns "zur vollkommenen Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen" lässt, die Einheit in Wahrheit und Liebe (vgl. Eph 4, 12-15). Archivfoto: Kardinal Müller im Presseraum des Vatikans (c) Michael Hesemann
VIDEO-TIPP: Der Gottmensch Jesus Christus - Historische Zeugnisse (2) von Weihbischof em. Marian Eleganti
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu | 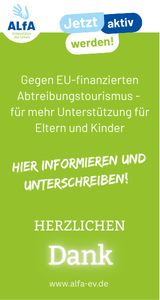       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
