 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:   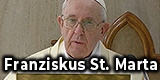  Top-15meist-diskutiert
|  Die Spieler im Fall Röschenz9. November 2005 in Schweiz, keine Lesermeinung Worum geht es eigentlich in Röschenz? Nach der Sondersynode ist die Verwirrung stark angestiegen. Eine kommentierte Analyse von Stefan Maria Bolli versucht den Durchblick. Alt St. Johann (www.kath.net, sb) Ein Kloster verweigerte seinen Aushilfsdienst in der umstrittenen Gemeinde, andere Kirchgemeinden solidarisierten sich mit Röschenz. Theologische Differenzen um gelebte Beziehungen, Zölibat, Frauenpriestertum, Demokratie in der Kirche, Gehorsam und anderes kamen dazu. Und natürlich spielten die säkularen Medien mit und gaben dem angeblichen David - gegen Goliath - eine nicht zu überhörende Stimme. Wer blickt da noch durch? Wer kann da noch ein einigermaßen gerechtes Urteil fällen? Genau dies fragte Martin Zihlmann, Mitglied des staatskirchenrechtlichen Parlamentes des Kantons Basel-Landschaft (Synode), seine Kollegen und gab die Antwort auch gleich selber: Wir sind nicht urteilsfähig. Franz Sabo, Priester des Erzbistums Bamberg in Deutschland, ist seit 1992 freigestellt für den Dienst im Bistum Basel. Die Gründe dafür sind weitgehend unbekannt. Der Generalvikar des Erzbistums Bamberg, Alois Albrecht, wird in der NZZ am Sonntag vom 17. April mit den Worten zitiert: In den Auseinandersetzungen mit Franz Sabo ging es letztlich immer um sexuelle Fragen. Sabo selber bestätigte in der gleichen Zeitungsausgabe, dass Krach mit den Vorgesetzten wie ein roter Faden durch sein Leben gehe. Er wohne mit seinem besten Freund und seiner besten Freundin zusammen und lebe seine Sexualität, veröffentlichte er in einer Sendung des Schweizer Fernsehens DRS. Sabo will die Kirche demokratisieren, das Frauenpriestertum einführen, den Fall des Pflicht-Zölibates und andere Anliegen vorantreiben. Sabo ist nicht der Kern der Auseinandersetzung Aber ist Sabo der Kern der Auseinandersetzung? Nein. Obwohl der nordbayrische Priester einer der aktivsten Hauptspieler und Gegenstand vieler Diskussionen und Emotionen ist, stellt er nicht mehr dar als den Stein des Anstosses, der die Lawine ins Rollen gebracht hat durch seine öffentlichen Angriffe gegen Bischof Kurt Koch. Röschenz spielte schon bald mit. Eine Kirchgemeinde in der Schweiz bezahlt die kirchlichen Arbeiter. Die Kirchgemeinderat wird demokratisch gewählt und funktioniert nach demokratischen Grundsätzen. Die Kirchgemeinde untersteht staatlichen Gesetzen und ist deshalb Teil des staatskirchenrechtlichen Systems der Schweiz als Pendant zur Pfarrei. Die Kirchgemeinde Röschenz unterstützt Sabo hauptsächlich. Deren Vorstand steht felsenfest hinter ihrem Ex-Pfarradministrator. Alle 415 anwesenden Gläubigen stimmten an der Kirchgemeindeversammlung vom 12. April für die Weiteranstellung, auch ohne rechtliche Grundlage. Rund 500 Gläubige kamen aber nicht zur Versammlung. Es ist anzunehmen, dass manche von ihnen einfach Angst haben, ihre Meinung frei zu äußern angesichts der Emotionen und infolge von gruppenzwangähnlichen Phänomenen. Personenkult um Franz Sabo Selbst Kinder, neu aufgenommene Ministranten, riefen bei ihrem ersten feierlichen Dienst den Gläubigen zu: Wir wollen unseren Pfarrer behalten. Die Gläubigen strömen in Scharen in die Veranstaltungen der Kirchgemeinde Röschenz Anzeichen für einen veritablen Aufschwung, aber auch für einen Personenkult um Franz Sabo. Dies bestätigt sich, wenn Aussagen wie Sabo hat mich erst in die Kirche gebracht, ohne ihn macht für mich Kirche keinen Sinn fallen. Es geht bei solchen Gläubigen nicht in erster Linie um den real gegenwärtigen Jesus Christus in der konsekrierten Hostie, sondern um die Person Franz Sabo. Es kann schon passieren, dass Sabo im Kirchenschiff sitzt, während ein Wortgottesdienst gefeiert wird, geleitet von einer Katechetin. Und komischerweise kann in diesem Wortgottesdienst, wie ihn die Basler Zeitung am 31. Oktober schildert, Sabo als erster begleitet von den Ministranten bei der Brot-Segnung eine heilige Hostie in Empfang nehmen. Die massive Klammerung an die Person Franz Sabo hat geschichtliche Gründe, denn in der Vergangenheit hatte die Kirchgemeinde Röschenz nicht immer Glück mit ihren Seelsorgern. Ob es nun besser ist? Da könnten sich viele täuschen. Einer der Vorgänger Sabos stand unter dem Verdacht sich an Buben vergriffen zu haben, bis er sich das Leben nahm, ein Inder mit limitierten Deutschkenntnissen erwartete nach seelsorgerlichen Dienstleistungen finanzielle Zuwendungen. Blieben diese aus, gab es keine Dienstleistungen mehr. Ein Dritter brannte mit der Frau eines Gläubigen durch. Aber auch die Kirchgemeinde stellt nicht das Kernproblem dar. Sie handelt massgeblich aus Angst um ihr momentan florierendes Kirchenleben, obschon der Personenkult als klarer Irrweg ignoriert wird. Die Röschenzer könnten sich ein Leben mit Bischof Koch vorstellen, sagen sie, wenn er sich denn den Gegebenheiten anpassen würde. Wurzel des Problems liegt im Staatskirchenrecht Ein maßgebliches Problem ist das Staatskirchenrecht. Gemäß diesem Recht steht die Landeskirche eines Kantons über der Kirchgemeinde. Die Landeskirche hat ein Parlament (Synode) und eine Exekutive (Landeskirchenrat). Sie ist das Parallelorgan zum Bistum, nur stehen dem Bistum Basel zehn Landeskirchen gegenüber. Obwohl sich der Landeskirchenratspräsident in seinem Plädoyer zur Verfassung bekennt und ausführt, dass die Landeskirche ihren Zweck in der Bereitstellung von finanzielle Mitteln und organisatorische Fragen zu Gunsten der römisch-katholischen Kirche sieht, tönt es ganz anders in der Synode, wenn sie beschließt: Der offenkundige Reformstau in unserer Kirche verlangt die Pflege einer offenen Gesprächskultur und in unseren schweizerischen Verhältnissen die konstruktive Zusammenarbeit zwischen staatskirchenrechtlich-landeskirchlichen und kanonisch-diözesanen Gremien und Instanzen. Es geht nicht an, dass die unaufschiebbare sachliche Lösung der Probleme um Sakramentenpastoral (im ökumenischen Kontext Interkommunion, im Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen und Homosexuellen Zulassung zu den Sakramenten), Ämterfrage (namentlich Frauenordination) und episkopale Communio (ortskirchliche Autonomie und päpstlicher Petrusdienst) von unten polemisiert und von oben tabuisiert wird. Wir erwarten deshalb von unserem Bischof, dass er diesen Handlungsbedarf auch in der Öffentlichkeit beim Namen nennt und im Schulterschluss mit andern Bischöfen in Rom anmeldet. Wir verweisen dabei auf die von unserer Synode am 2. Dezember 2003 beschlossene Unterstützung der Erklärung der Luzerner Synode. Die Landeskirche macht damit ganz klar Kirchenpolitik und zeigt das Gefühl der trotzigen Frustration von unten. Konflikt um Sabo wird missbraucht Die Landeskirche missbraucht den Konflikt um Franz Sabo, um ihren theologischen Forderungen an den Bischof und die Universalkirche Nachdruck zu verleihen. Im gleichen Atemzug will sie zwischen den Parteien vermitteln und noch einmal im gleichen Atemzug will sie den Bischof überprüfen, ob er sich richtig verhalten hat. Diese Absurdität verlangt viel Fantasie, um sie zu verstehen. Bei allen genannten Parteien gibt es zahlreich Solidarisierende Priester stellen sich demonstrativ neben Sabo, Kirchgemeinden hinter Röschenz und Landeskirchen verbrüdern sich mit der Synode und dem Rat von Basel-Landschaft. Sie wollen damit den Forderungen Gewicht verleihen. Es ist gleichzeitig ein Spiegelbild des katholischen Glaubens in der Schweiz: Viele laute gegen wenige leise. Staatskirchenrecht gegen römisch-katholische Kirche Die Haltung und Motivation der Landeskirche und auch der Kirchgemeinde als Glied von ihr zeigt wiederum eine neue Dimension des Konfliktes: Staatskirchenrechtliche Strukturen gegen die kanonische, römisch-katholische Kirche. Geschaffen wurde dieses System staatlicher Kirche, um gemeinsam die katholischen Anliegen zu befriedigen: Die staatskirchlichen Körperschaften sollten die weltlichen Anliegen und die kanonische Kirche die Fragen des Glaubens, der Disziplin und der Moral lösen. Der Staat beeinflusst in der Schweiz mittlerweilen massiv die Kirche. Es gibt heute viele Konflikte zwischen Pfarrer und Kirchgemeinden, zwischen Kirchgemeinden/Landeskirchen und dem Bistum. Die Landeskirchen spielen sich zum innerkirchlich-theologischen Staatsanwalt auf und hätten gerne die Oberaufsicht über das Bistum auch in innerkirchlichen Fragen. Kirche ist Spielball des Staates Die eigentliche Kirche ist dem Staat gänzlich untergeordnet und Spielball des Staates. Schließlich befiehlt, wer zahlt. Der Bundesstaat Schweiz hat sich verpflichtet, der Kirche in Organisationsfragen und innerkirchlichen Belangen nicht fordernd entgegenzutreten. Papier ist aber geduldig, besonders wenn es ein internationaler Vertrag ist, der nicht ratifiziert oder umgesetzt wurde. Ob das noch im Sinne des Stifters der una sancta catholicam et apostolicam ecclesiam ist? Giusep Nay, oberster Bundesrichter in der Schweiz, drückt das im Tagesanzeiger so aus: Religionsfreiheit heißt, dass der Mensch denjenigen Glauben ausüben kann, den er will. Da hält sich der Staat vollständig zurück. Nur insofern diese Glaubensausübung auch Auswirkungen hat auf das staatliche und öffentliche Leben, kann der Staat der Kirche Auflagen machen. Man kann nicht sagen, dass die Kirche demokratisiert wird. Man fügt höchstens ein demokratisches Element in die Kirche ein. Den eigentlichen Motor des Konflikts übernehmen aber die säkularen Medien. Sie helfen dem David dem Schwachen, das sind Sabo, die Landeskirche etcetera gegen Goliath Bischof Koch und mit ihm die römisch-katholische Kirche. Sie merken nicht, dass die Rollen in der Öffentlichkeit vertauscht sind: In der Bibel ist Goliath jener, von dem die Bedrohung ausgeht, in Röschenz ist es die drohende Spaltung durch Sabo/Staatskirchentum. Die Medien ergreifen ausschließlich Partei für Röschenz /Sabo und die Landeskirche. Sie drehen die Werte um: Schützt der Bischof die Persönlichkeit Sabos vor den Medien, wird ihm das als Persönlichkeitsverletzung angelastet, sachliche Begriffserklärungen werden als Drohungen tituliert, sündhaftes Verhalten als lobenswert und mutig dargestellt. Robin Hood im Kampf gegen die Ungerechtigkeit Dabei fördern sie den Personenkult um Franz Sabo und lösen eine Massenhysterie aus, die an vorrevolutionäre Wirren erinnert. Eigentlich sind sie es, die Sabo keinen Ausweg mehr lassen, denn Sabo wird von den Medien brutal als Symbolfigur öffentlich gemacht und als Robin Hood zum Helden des Kampfes gegen die Ungerechtigkeit in der Kirche stilisiert. Persönlichkeitsschutz ist das nicht, im Gegenteil. Sabo wird verzweckt für die Kirchenpolitik der Landeskirchen und Medien. Was ist nun die Pflicht eines Bischofs? Er garantiert die Einheit in seiner Teilkirche. Diese Einheit kann, ja muss, verschieden verstanden werden: sakramental, theologisch, disziplinär. Aber Einheit mit wem? Einheit zwischen der Teilkirche und der Universalkirche und Einheit innerhalb seiner Teilkirche. Zusammen mit den anderen Bischöfen unter der Leitung des Papstes ist er wie ein Apostel im Kreise der Zwölf. Das II. Vatikanische Konzil sagt dazu in der dogmatischen Konstitution lumen gentium 23: Aber kann das Bischof Koch überhaupt noch? Ist er in dem staatskirchenrechtlichen Korsett gezwungen, die Einheit mit der Weltkirche dem Frieden in Röschenz aufzuopfern? Erst wenn der Bischof den tödlichen Strick Staatskirchentum los wird, wird Einheit wieder möglich. Denn die Spaltung ist nicht mehr zu verhindern. Sie ist bereits traurige Realität, innerhalb der Pfarrei und innerhalb des Bistums. KATH.NET-Bericht über die Sondersynode Die bei KATH.NET veröffentlichten Kommentare spiegeln die Meinungen der jeweiligen Autoren. Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber wieder. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuSchweiz
|       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
