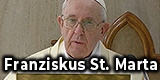SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln: 

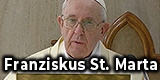

Top-15meist-diskutiert- R.I.P. Papst Franziskus
- Papa Francesco – ein Papst, der die Menschen liebte
- Initiative "Neuer Anfang" protestiert gegen Handreichung von DBK/ZDK "für die Praxis der Segnung"
- Franziskus war ein „Papst wie du und ich“
- Kardinal Müller: „Es gibt legitim über 20 verschiedene Riten derselben katholischen Messe“
- Kardinäle aus weit entfernten Regionen kritisieren: Das Präkonklave beginnt „zu früh“
- Kardinal Müller hofft, dass der zukünftige Papst den Islam-Dialog überdenkt
- "Es gibt nichts Schöneres, als Ihn zu kennen und anderen die Freundschaft mit Ihm zu schenken"
- Der Anker und der Mann mit dem hörenden Herzen
- Kardinal Erdö ist bereits in Rom - "Franziskus war Papst der Völker"
- US-Präsident Donald Trump reist zum Papst-Begräbnis
- Papst Franziskus nach Überführung im Petersdom aufgebahrt
- US-Regierung lässt negative Folgen von ‚Geschlechtsänderungen‘ erforschen
- Bischof Hanke: „Als Christen und als Staatsbürger für das Lebensrecht der Schwächsten demonstrieren“
- Kardinal Koch: Einheit der Christen war Franziskus großes Anliegen
| 
Das Pallium pontificalis officii plenitudo28. Juni 2011 in Aktuelles, keine Lesermeinung
Druckansicht | Artikel versenden | Tippfehler melden
Am 29. Juni wird Papst Benedikt XVI. den neu ernannten Erzbischöfen das Pallium überreichen. Zur Geschichte dieses antiken Hoheitszeichens. Von Armin Schwibach
Rom (kath.net/un/as) Seit Juli 2010 hat der Historiker, Theologe und Vatikanspezialist Ulrich Nersinger mit dem ersten Band des monumentalen Werkes Liturgien und Zeremonien am Päpstlichen Hof (539 Seiten mit 267 Abbildungen, Bonn 2010 Verlag nova&vetera) das Ergebnis einer vieljährigen Forschungsarbeit vorgelegt. Eingehende Recherchen in staatlichen und privaten Bibliotheken sowie in verschiedenen Archiven des Vatikans, Italiens und anderer Länder verbunden mit einer tiefen Kenntnis des Geschehens im Vatikan ermöglichten ein Buch, das in seiner Art als einzigartig betrachtet werden kann. Nersinger setzte sich das Ziel der Vollständigkeit der aufgearbeiteten Quellen und ermöglicht einen Einblick in eine Welt, der wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und sich gleichzeitig unterschiedslos an alle historisch interessierten gesellschaftlichen Gruppen wendet. Der Anmerkungsapparat sowie die umfangreiche mehrsprachige Bibliographie, in die auch die neun digitalen Medien Eingang gefunden haben, dienen zur Dokumentation der behandelten Themen und präsentieren sich als Ergebnis einer an andere Wissenschaftler gerichteten Anstrengung. Der zweite Band (geplantes Erscheinungsdatum: Sommer/Herbst 2011) wird folgende Kapitel enthalten: Riten und Zeremonien rund um das Kardinalat (Konsistorien, Kreierung der Kardinäle, Kleidung, Residenz und Familie der Purpurträger, Besitzergreifung einer Titelkirche oder Diakonie, Entsendung von Kardinälen als Legaten), Selig- und Heiligsprechungen, die Feier der Heiligen Jahre, Weihe und Übergabe päpstlicher Ehrengeschenke (Agnus Dei, Die Goldene Rose, Schwert und Hut, Petrusschlüssel und Banner sowie die fasce benedette), die Chinea (eine Tributverpflichtung gegenüber dem Papst), die Audienzen des Papstes sowie Tod und Beisetzung des Papstes.
Anlässlich des Hochfestes Peter und Paul, an dem der Papst vierzig im Lauf des Jahres ernannten Erzbischöfen das Pallium überreichen wird (unter den neuen Erzbischöfen, die nach Rom kommen, sind Zbignev Stankevics (Riga), Marjan Turnsek (Maribor), Cesare Nosiglia (Turin), Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo (Jakarta), Jose Horacio Gomez (Los Angeles), Guire Poulard (Port-au-Prince/Haiti), Jesus Ruben Salazar Gomez (Bogota) sowie Brasiliens Primas Murilo Sebastiao Ramos Krieger (Sao Salvador da Bahia). Weitere fünf werden es in ihren Heimatdiözesen empfangen), veröffentlicht kath.net einen Auszug aus dem Buch Nersingers, der sich mit der Geschichte dieses Hoheitszeichens auseinandersetzt. Der Bericht hebt an in dem Moment, da die am Agnestag vom Papst gesegneten Lämmer, aus deren Wolle das Pallium gewoben wird, von den Schwestern eines Klosters in Trastevere, die sich um sie gekümmert hatten, geschoren werden.
Ulrich Nersinger
Das Pallium pontificalis officii plenitudo (...)
In ihrem Kloster im römischen Stadtviertel Trastevere scheren die Schwestern in der Karwoche die Lämmer. Unter Verwendung dieser Wolle fertigen sie die Pallien (1) an: weiße, mit schwar¬zen Kreuzen versehene ringförmige Bänder, die um die Schultern auf das Me߬gewand des Papstes, der Patriarchen und der Metropolitanerzbischöfe gelegt werden, und von de¬nen ein Streifen über die Brust, der andere über den Nacken herabfällt. Die Enden der beiden Streifen sind mit in schwarzer Seide eingenähten Bleiplättchen be¬schwert. Auf dem sechs Zentimeter breiten Ringband befinden sich vier schwarze Kreuze, auf den beiden Streifen je eines (2). An den Kreuzen sind Schlaufen (ansulae) angebracht, durch die kostbare Nadeln (spinulae, fibulae) gezogen werden können. Die Nadeln dienten früher dazu, das Pallium an der Kasel festzuhef¬ten; heute aber sind sie nur noch Zier (der Diakon, der die Nadeln anzubringen hat, mußte nach den Vorschriften des alten Caeremoniale Episcoporum darauf achten, daß sie weder das jeweilige Kreuz noch das Pallium durchbohrten, noch die Kasel berührten; der edelsteinbesetzte Nadelkopf hatte vom Betrachter aus gesehen stets rechts zu liegen) (3) . Von Santa Cecilia werden die kostbaren Gewandstücke nach St. Peter gebracht, wo sie verschlossen in einem aus vergoldetem Silber angefertigtem Kästchen in einer Nische, der sogenannten Nicchea dei Palli, der Palliennische, über dem Grab des ersten Bischofs von Rom aufbewahrt werden (4). Hier ruhen sie, bis sie am Vigiltag des Festes der Apostelfürsten vom Papst nach der Feier der Vesper gesegnet werden und am folgenden Tage den zu Verleihenden überreicht werden. Das Pallium des Papstes, der Patriarchen und Metropoliten wird gleichsam de corpore beati Petri sumptum vom Grab des heiligen Petrus genommen.
Geschichtlich dürfte das Pallium auf das lorum, das Oberteil der toga trabea, zurückzuführen sein, eines Gewandes, das der römische Kaiser bei Staatsakten und festlichen Angele¬gen¬heiten anzuziehen pflegte (5). Die Konstantinische Schenkung berichtet, daß Kai¬ser Konstantin der Große (+337) es dem Bischof von Rom verliehen habe Beato Silvestro contradimus ... necnon et superhumerale, videlicet lorum, qui imperiale circumdare assolet collum, heißt es in der berühmten, aus dem 8. Jahrhundert stammenden Schrift (6). In der Ewi¬gen Stadt galt das Pallium schon sehr früh als ein den Papst besonders kennzeichnen¬der Schmuck, als Abzeichen seiner obersten Hirtengewalt. Das Pallium wurde zur eigentlichen Insignie des Papstes in der Vita Valentini (827) wird es daher zu Recht die summi pontificatus infula genannt (7).
Erste sichere Erwähnungen dieses Gewandstückes als päpstliche Insignie finden sich schon im 5. Jahrhundert. Um das Jahr 530 verlieh Papst Markus das Pallium dem suburbikarischen Bischof von Ostia; als Begründung wurde angegeben, daß diesem das Recht zustehe, den Papst, falls dieser noch nicht mit der Priester- oder Bischofswürde ausgezeichnet sei, die heiligen Weihen zu erteilen (8). 
Daß der Heilige Vater dann den Metropoliten, den Vorstehern der Kirchenprovinzen, dieses Gewandstück zukommen ließ, war zunächst nur Ausdruck der vom Papst beabsichtigten inni¬geren Einheit dieser Würdenträger mit dem Apostolischen Stuhl; im Laufe der Jahrhunderte wurde das Pallium jedoch immer mehr zu einer charakteristischen Insignie der Metropoliten, zum Zeichen ihrer besonderen Vollmacht. Der Metropolit war und ist auf das Pallium angewiesen, um bestimmte Pontifikalhandlungen, insbesondere Bischofsweihen, rechtmäßig vorzunehmen (9); schon Papst Paschalis II. stellte unmißverständlich fest: Im Pallium wird die Fülle der pontifikalen Gewalt gewährt, da es gemäß der Gewohnheit des Apostolischen Stuhles und des ganzen Europa den Metropoliten vor Empfang des Palliums durchaus nicht gestattet ist, Bischöfe zu weihen oder Synoden zu halten (10). Das Pallium bezeugt bei den Bischofsweihen, daß der Metropolit vice Summi Pontificis handelt so wird also jeder Bischof vom Papst oder dessen Vertreter (Metropolit) geweiht ... Der Papst erscheint so, wie Clemens II. 1047 sagt, nicht bloß als der Pastor ovium, sondern auch als der pastor omnium aliorum pastorum, von dem die Bestellung aller Hirten ausgeht, als episcopus episcoporum (Eduard Eichmann) (11). Um die besondere Stellung der Vorsteher der Kirchenprovinzen hervorzuheben, ordnete Papst Paul VI. (Giovanni Battista Montini, 1963-1978) am 11. Mai 1978 durch das Motu Proprio Inter Eximia (12) an, daß das Pallium künftig nur den Metropoliten und dem Lateinischen Patriarchen von Jerusalem zu verleihen sei. In der lateinischen Kirche gab es bis dahin 29 Erzbistümer, die keine Metropolitansitze waren, deren Oberhirten sich aber dennoch aufgrund geschichtlicher Gunsterweise der Päpste des Palliums erfreuten; außerdem stand es 18 Bischofssitzen als Privileg zu (acht in Frankreich, sieben in Italien, zwei in Ungarn und einem in Polen). Ferner war es üblich geworden, verdiente Titularerzbischöfe mit dem Pallium auszuzeichnen. Was den Kardinaldekan betraf, blieben die Bestimmungen des Codex Iuris Canonici von 1917 (13) und der Apostolischen Konstitution Romani Pontificis eligendo aus dem Jahre 1975 (14) weiterhin in Kraft.
Die Verleihung des Palliums
Wenn ein neuer Papst sein Oberstes Hirtenamt antrat, erhielt er zu Beginn der Liturgie, mit der er seine hohe Aufgabe symbolisch übernimmt, dieses Würdezeichen überreicht. Der ranghöchste Kardinaldiakon trug das Pallium vom Altar zur päpstlichen Kathedra und legte es dem Heiligen Vater um die Schultern: Accipe Pallium sanctum, plenitudinem Pontificalis officii, ad honorem omnipotentis Dei, et gloriosissimae Virginis Mariae eius Matris, beatorum Apostolorum Petri et Pauli, et Sanctae Romanae Ecclesiae Empfange das heilige Pallium, und mit ihm die Fülle des päpstlichen Amtes, zur Ehre des Allmächtigen Gottes, und der allerglorreichsten Jungfrau Maria, seiner Mutter, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, und der Heiligen Römischen Kirche. Seit dem Amtsantritt Papst Johannes Pauls I. (Albino Luciano, 1978) lautete die Formel: Benedictus Deus, qui Te pastorem Ecclesiae universae elegit, qui candida stola apostolatus Tui Te circumdedit. Fulgeas hic in gloria per longa huius vitae tempora donec a Domino Tuo vocatus, possideas stolam immortalitatis in solio regni caelestis Gepriesen sei Gott, der Dich zum Hirten der ganzen Kirche erwählt hat und Dich mit der weißen Stola Deines Apostolischen Dienstes umgibt. Mögest Du in diesem Glanze für lange Jahre Deines irdischen Lebens wirken und, wenn der Herr Dich einst ruft, mit der Stola der Unsterblichkeit bekleidet in sein himmlisches Reich eingehen (15). Alle Metropoliten sind durch das Kirchenrecht verpflichtet, unmittelbar nach ihrer Bestätigung oder Ernennung in einem Konsistorium um das Pallium anzusu¬chen (16). Die Übergabe des Palliums geschieht für gewöhnlich am Hochfest der heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus in der Petersbasilika. Der Papst verleiht es persönlich oder durch den rangältesten Kardinaldiakon. Das Pallium wurde mit den Worten aufgelegt: Ad honorem omnipotentis Dei, ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli, (Domini Nostri N. Papae N.,) et Sanctae Romanae Ecclesiae, necnon Ecclesiae N. tibi commissae, tradimus tibi Pallium de corpore beati Petri sumptum, in quo est plenitudo Pontificalis officii, cum Patriarchalis, vel Archiepiscopalis nominis appellatione, ut utaris eo intra Ecclesiam tuam certis diebus, qui exprimuntur in privilegiis Apostolica Sede concessis. In nomine Paris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen Zu Ehren des allmächtigen Gottes, der seligen allzeit reinen Jungfrau Maria, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, (unseres Herrn, des Papstes N.) der heiligen römischen und Dir anvertrauten Kirche übergeben Wir Dir das vom Leibe des heiligen Petrus genommene Pallium, in welchem die Fülle des bischöflichen Amtes liegt, zugleich mit dem Titel Patriarch (oder Erzbischof), auf daß Du es innerhalb Deiner Kirche an den in den Privilegien des Apostolischen Stuhles bestimmten Tagen gebrauchen mögest. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen (17). Mit Inkrafttreten des Motu Proprio Inter eximia vom 11. Mai 1978 strich man jedoch aus dieser Formel des Pontificale Romanum die Bezeichnung Patriarch. Der Papst und die Metropoliten verwenden das Pallium nur bei der Feier der heiligen Messe. Während es der römische Bischof aufgrund seines Obersten Hirtenamtes überall auf der Welt trägt, ist den Metropoliten der Gebrauch nur innerhalb ihrer Kirchenprovinzen gestattet. Joseph Braun führt diesen Umstand wie folgt aus: Jenem kommt die Insignie von Rechts wegen und unabhängig von irgend eines Menschen Genehmigung zu. Diese dürfen sie nur auf Grund der Bevollmächtigung tragen, welches sie auf ihr Ansuchen hin vom Apostolischen Stuhle empfingen. Beim Papste ist das Pallium ferner der Ausdruck der ihm kraft göttlicher Anordnung eigenen höchsten Hirtengewalt, bei den Metropoliten ist es dagegen das Symbol der ihnen vom Nachfolger Petri für eine bestimmte Kirchenprovinz gewährten und auf lediglich kirchlichem Recht beruhenden Theilnahme an dessen oberster Hirtengewalt (18). Ein Metropolit, der zum Vorsteher einer anderen Kirchenprovinz berufen wird, muß beim Papst um ein neues Pallium ansuchen; er darf sich des alten nicht weiter bedienen. Tritt ein Metropolit von seinem Amt zurück, wird er bei seinem Begräbnis nicht mit dem Pallium um die Schultern beerdigt; es wird ihm zusammengefaltet unter den Kopf gelegt (19). Der Gebrauch des Palliums
Als Tage, an welchen den Metropoliten das Pallium gestattet war, nannte das alte Pontificale Romanum: Weihnachten, Beschneidung des Herrn, Epiphanie, die drei Ostertage, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Fronleichnam, dann die Feste der Reinigung, Verkündigung, Aufnahme, Geburt und Unbefleckten Empfängnis Mariens, das Fest der Geburt des heiligen Johannes des Täufers, des heiligen Joseph und des heiligen Erzmärtyrers Stephanus, die Aposteltage und Allerheiligen. Ferner durfte es getragen werden an Palmsonntag, Gründonnerstag, Karsamstag, am Weißen Sonntag sowie an den vornehmsten Festen der Metropolitankirche, am Kirchweihfest und dem Jahrestag der Konsekration des betreffenden Metropoliten. Erlaubt war der Gebrauch des Palliums auch bei der Erteilung der heiligen Weihen, der Weihe eines Bischofs und der Benediktion von Äbten und Äbtissinnen (20). Das neue Caeremoniale Episcoporum aus dem Jahre 1984 sieht den Gebrauch des Palliums bei der Liturgie vor, die der Bischof als Missa Stationalis oder mit großer Feierlichkeit zelebriert, ferner bei der Erteilung der heiligen Weihen, der Benediktion von Äbten und Äbtissinnen, der Jungfrauenweihe sowie der Weihe von Kirchen und Altären (21). Der Heilige Vater bediente und bedient sich des Palliums bei allen Meßfeiern, die er öffentlich und in pontificalibus zelebriert (bei den Messen in seiner Privatkapelle verwendet er die Insignie nicht, auch dann nicht, wenn eine größere Gruppe von Gläubigen anwesend sein sollte). Zwischen dem Pallium der frühchristlichen Zeit und demjenigen der Gegenwart besteht der Gestalt nach eine gewisse Verschiedenheit. Joseph Braun bedauerte dies in seinen wissenschaftlichen Untersuchungen und klagte: Aus dem in leichtem, lebendigem und malerischem Flusse die Brust, die Schultern und den Nacken umschlingenden Bande ist ein schmächtiger Ring geworden, von welchem vorn und rückwärts ein kurzer Streifen steif herabhängt (22). Aus Anlaß des Heiligen Jahres 2000 war im Vatikan, im Amt für die liturgischen Zeremonien des Heiligen Vaters, die Überlegung aufgetaucht, zu einer der älteren (angenommenen) Formen der Insignie zurückzukehren. In der mitternächtlichen Weihnachtsmesse des Jahres 1999 trug der Papst daher ein breites, grobwollenes Pallium, das bis zum Saum seines Meßgewandes hinab reichte (23). Es dürfte jedoch auf keine Zustimmung gestoßen sein; denn es wurde im Pontifikat Johannes Pauls II. nur dieses eine Mal verwendet. Die Weihe der Lämmer und die Überreichung der Pallien gehören zu den wenigen Zeremonien, die man vom alten Päpstlichen Hof in das neue Päpstliche Haus hinüberrettete (24); die liturgischen Texte wurden fast unverändert übernommen, wenn auch der Gebrauch der italienischen Sprache, zumindest was die Weihe betrifft, nun das altehrwürdige Latein verdrängt hat. In seiner 2004 erschienenen Autobiographie erinnert sich Papst Johannes Paul II. an das tiefe und bewegende Zeichen des Palliums, das ich selbst im Jahr 1964 erhielt. In der Welt tragen die Metropoliten zum Zeichen der Einheit mit Christus, des guten Hirten, und mit seinem Vikarius, der die Aufgabe des Petrus übernimmt, auf den Schultern dieses Zeichen, der aus der Wolle der Lämmer gewebt wird, die am Gedenktag der hl. Agnes geweiht werden. Viele Male habe ich es als Papst am Fest der heiligen Apostel Petrus und Paulus den neuen Metropoliten übergeben können. Welch schöne Symbolik! In der Form des Palliums können wir das Bild eines Schafes erblicken, das der gute Hirte auf seine Schultern hebt und mitnimmt, um es zu retten und zu nähren. In diesem Symbol wird sichtbar, was uns alle als Bischöfe in erster Linie eint: die Fürsorge und die Verantwortung für die uns anvertraute Herde. Gerade aufgrund dieser Fürsorge und dieser Verantwortung müssen wir die Einheit pflegen und wahren (25).
Anmerkungen:
(1) Leo, M. P., De auctoritate et usu Pallii Pontificii, Roma 1649 Moroni, G., Pallio, in: Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica LI (1851), 53-54 Trobetta, A., De pallio archiepiscopali. Elucubratio canonico-lirturgico-historica, Sorrento 1923 - Siffrin, P., Pallio, in: Eniclopedia Cattolica IX (1952), 646-647 Weber, F. J., The Sacred Pallium and Its History, in: Liturgical Arts 30 (1962), 91-106 Nersinger, U., Insignien und Gewandung des Papst einst und jetzt. Das Pallium, in: Pro Missa Tridentina, Nr. 27, Dezember 2003, 28-35.
(2) Ursprünglich dürften die Kreuze purpurfarbenen gewesen sein (Rerum Liturgicarum, lib. I, cap. 24, num. 16).
(3) Der zwölfte Ordo Romanus spricht davon, daß die Nadeln mit Hyacinthen verziert seien; die Nadeln, die man im Grab Bonifaz VIII. fand, waren mit Saphiren geschmückt.
(4) Basso, M., La Nicchia dei Palli sulla Tomba di San Pietro in Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana 1985 (= Sonderdruck aus: Notitiae, Nr. 230-231, Settembre-Ottobre 1985, 497-519).
(5) Wilson, L. M., The Roman Toga, Baltimore 1924 Alföldi, A., Insignien und Tracht der römischen Kaiser, in: Römische Mitteilungen 50 (1935), 25-38 Wrede, H., Zur Trabea, in: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Institutes, Bd. 103 (1988).
(6) Hinschius, Decret. Pseudo-Isidor, 253.
(7) Andrieu, M., Le Pontifical Roman au Moyen Age, II, a. a. O., 370.
(8) Liber Pontificalis, ed. Duchense, I, 81. Auch noch in unseren Tagen wird jedem neuen Kardinaltitular von Ostia diese Insignie verliehen; so übergab Johannes Paul II. am 15. März 2003 dem neu erwählten Dekan des Heiligen Kollegiums, Joseph Kardinal Ratzinger, in der Kapelle Redemptoris Mater des Apostolischen Palastes das Pallium. Nicht erklärbar ist der Umstand, warum Kardinal Angelo Sodano, der Nachfolger von Kardinal Ratzinger im Amt des Dekans des Heiligen Kollegiums, bei der Besitzergreifung der suburbikarischen Diözese von Ostia (10. Juli 2005) über dem Meßgewand das Pallium trug (Eucharistiefeier zur Inbesitznahme der suburbikarischen Kirche von Ostia in der Kathedrale der heiligen Märtyrerin Aurea, in: LOsservatore Romano, Wochenausgabe in deutscher Sprache, Nr. 30/31, 29. Juli 2005, 2).
(9) So der alte CIC von 1917 in den cann. 275-279.
(10) Migne, CLXIII, 428.
(11) Eichmann, Ed., Weihe und Krönung des Papstes im Mittelalter (=Münchener Theologische Studien, III. Kanonistische Abteilung, 1. Band) München 1951, 21.
12 Paulus PP. VI, Litterae Apostolicae Inter eximia die XI mensis Maii 1978, in: AAS 70 (1978), 441-442.
(13) Can. 239, § 2.
(14) AAS 67 (1975), 644-645.
(15) Missa celebrata dal Papa Giovanni Paolo I per linizio del Suo Ministero di Supremo Pastore, Piazza S. Pietro 3 Settembre 1978, a cura dellUfficio per le Cerimonie pontificie, Tipografia Poliglotta Vaticana 1978, 19-20; deutsche Übersetzung vom Verfasser.
(17) CIC 1917, can. 275; CIC 1983, can. 437, §1. Das Pallium wird mit den Worten erbeten: Ego N. electus Ecclesiae N. instanter, instantius, instantissime peto mihi tradi et assignari Pallium de corpore Sancti Petri sumptum in quo est plenitudo pontificalis officii (zitiert bei: Heim, B. B., Heraldry in the Catholic Church, Gerrads Cross 1978, 72).
(18) Pontificale Romanum, Editio princeps (1595-1596), Edizione anastatica, Introduzione e Appendice a cura di Manlio Sodi Achille Maria Triacca in collaborazione di Gabriela Foti, Città del Vaticano 1997, 127-128.
(19)Braun, J., Die pontificalen Gewänder des Abendlandes nach ihrer geschichtlichen Entwicklung, Freiburg im Breisgau 1898, 135.
(20) Das Wissen um diese logische Vorschrift scheint verloren gegangen zu sein. Bei der öffentlichen Aufbahrung des Wiener Alterzbischofs Kardinal Franz König am 26. März 2004 im Stephansdom war der Verstorbene mit dem Pallium bekleidet (Photographien hierzu brachten die österreichische Tageszeitung Kurier in ihrer Ausgabe von Samstag, dem 27. März 2004, Nr. 87, 1, sowie die Wiener Kirchenzeitung vom 4. April 2004, Nr. 14, 3, 8, 9).
(21) Pontificale Romanum, Pars Prima, Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1962, 92-93.
quando Missam celebrat Stationalem vel saltem magna cum sollemnitate necnon quando ordinationes, benedictionem Abbatis et Abbatissae, consecrationem virginis, dedicationem ecclesiae et altaris peragit (Caeremoniale Episcoporum, Città del Vaticano 1984, Caput IV, Nr. 62).
(22) Braun, J., Die pontificalen Gewänder des Abendlandes nach ihrer geschichtlichen Entwicklung, a. a. O., 160.
(23) Ein Photographie, die den Heiligen Vater mit diesem Pallium zeigt, findet sich in: Berthod, B. - Blanchard, Trésors inconnus du Vatican, Paris 2001, 276.
(24) Eine Neuerung führte der Heilige Vater 2004 ein; da der 21. Januar auf einen Mittwoch fiel, empfing der Papst die beiden Lämmer während der an diesem Tag stattfindenden allwöchentlichen Generalaudienz (LOsservatore Romano, Wochenausgabe in deutscher Sprache , Nr. 5, 30. Januar 2004, 2).
(25) Johannes Paul II., Auf, lasst uns gehen ! Erinnerungen und Gedanken, Augsburg 2004, 159.
Ulrich Nersinger
Liturgien und Zeremonien am Päpstlichen Hof, Band 1
Verlag nova&vetera
Gebundene Ausgabe: 539 Seiten mit 267 Abbildungen;
EUR 49,-
Alle Bücher und Medien können direkt bei KATH.NET in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Christlicher Medienversand Christoph Hurnaus (Auslieferung Österreich und Deutschland) und dem RAPHAEL Buchversand (Auslieferung Schweiz) bestellt werden. Es werden die anteiligen Portokosten dazugerechnet. Die Bestellungen werden in den jeweiligen Ländern (A, D, CH) aufgegeben, dadurch entstehen nur Inlandsportokosten. Für Bestellungen aus Österreich und Deutschland: [email protected] Für Bestellungen aus der Schweiz: [email protected]
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!

LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder.
kath.net verweist in dem Zusammenhang auch an das Schreiben von Papst Benedikt zum 45. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel und lädt die Kommentatoren dazu ein, sich daran zu orientieren: "Das Evangelium durch die neuen Medien mitzuteilen bedeutet nicht nur, ausgesprochen religiöse Inhalte auf die Plattformen der verschiedenen Medien zu setzen, sondern auch im eigenen digitalen Profil und Kommunikationsstil konsequent Zeugnis abzulegen hinsichtlich Entscheidungen, Präferenzen und Urteilen, die zutiefst mit dem Evangelium übereinstimmen, auch wenn nicht explizit davon gesprochen wird." (www.kath.net)
kath.net behält sich vor, Kommentare, welche strafrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen, zu entfernen. Die Benutzer können diesfalls keine Ansprüche stellen. Aus Zeitgründen kann über die Moderation von User-Kommentaren keine Korrespondenz geführt werden. Weiters behält sich kath.net vor, strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. | 
Mehr zu | 






Top-15meist-gelesen- R.I.P. Papst Franziskus
- Franziskus war ein „Papst wie du und ich“
- Vatikan veröffentlicht Testament von Papst Franziskus
- Eine große BITTE an Ihre Großzügigkeit! - FASTENSPENDE für kath.net!
- Vandalismus in deutschen Kirchen: Beobachtungsstelle OIDAC alarmiert
- Urbi et Orbi Ostern 2025 - Das Lamm Gottes hat gesiegt! Er lebt, der Herr, meine Hoffnung
- Papst trifft US-Vizepräsident Vance im Vatikan
- Kardinäle aus weit entfernten Regionen kritisieren: Das Präkonklave beginnt „zu früh“
- Jerusalem: Die geheimnisvolle "Liturgie des Heiligen Feuers"
- Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. bleibt für uns ein starker Segen!
- US-Vizepräsident Vance bei Karfreitagsliturgie im Petersdom
- Papa Francesco – ein Papst, der die Menschen liebte
- Ostermesse auf dem Petersplatz. Im Staunen des Osterglaubens
- Patriarch Bartholomaios: Ostern immer gemeinsam feiern
- Kardinal Müller: „Es gibt legitim über 20 verschiedene Riten derselben katholischen Messe“
|