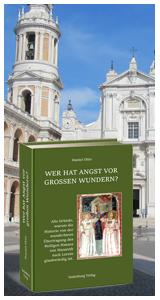SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln: 



Top-15meist-diskutiert- Bischof Bätzing meint: Regenbogenflagge am Reichstag ‚wäre ein gutes Zeichen gewesen‘
- „Er war aber auch ein Hetzer“. Über ein wiederkehrendes Argument zum Mord an Charlie Kirk
- Die Gender-Sprachpolizei des Bistums Limburg macht mobil
- R.I.P. Charlie Kirk - Ein Attentat erschüttert die USA
- Drei Nonnen für ein Halleluja
- Feminismus, Queer-Kultur – Wer ist die neue Präsidentin der Päpstlichen Akademie für die Künste?
- Leo XIV.: 'Demokratie nicht notwendigerweise die beste Lösung für alles.'
- Vatikan sieht die Welt "am Rand des Abgrunds"
- Brötchentüten für die Demokratie
- USA verhängen Einreisesperre für ausländische Charlie-Kirk-Mord-Jubler!
- Vatikan erfreut über Fortschritte in China: Diözese neugeordnet
- Deutscher ZDF-Korrespondent Theveßen steht vor dem Rauswurf aus den USA
- "Ich sehe nicht, wie die außerordentliche Form des Römischen Ritus Probleme verursachen könnte"
- Mordfall Charlie Kirk: Transgender-Parolen und antifaschistische Sprüche auf Patronen
- "Ihr habt keine Ahnung, was ihr entfesselt habt!"
| 
Offensichtlich geht es heute auch ohne Religion25. August 2025 in Kommentar, 15 Lesermeinungen
Druckansicht | Artikel versenden | Tippfehler melden
Über den schleichenden Bedeutungsverlust des Glaubens und den Auftrag der Kirche in einer säkularen Welt. Von Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer
Eichstätt (kath.net) 1. Not lehrt nicht mehr beten – Eine stille Zäsur
„Not lehrt beten“ – jahrhundertelang galt diese Redensart als Lebensweisheit. Wer leidet, sucht Trost bei Gott, Orientierung im Gebet, Halt in der Kirche. Doch diese religiöse Selbstverständlichkeit ist heute erschüttert. Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, Naturkatastrophen und persönliche Krisen hätten Anlässe zur geistlichen Rückbesinnung sein können – doch die große religiöse Rückkehr blieb aus.
Stattdessen: Schweigen. Rückzug. Austritte. Der Religionssoziologe Detlef Pollack bringt es auf den Punkt: „Not lehrt nicht mehr beten.“ Religion ist für viele keine Deutungsressource mehr, sondern eine ferne Erinnerung. Der Bedeutungsverlust ist nicht abrupt – sondern lautlos. Und eben darin liegt seine Brisanz.
2. Ein schleichender Rückzug – Zahlen, die sprechen
Der Rückgang kirchlicher Bindung ist dramatisch – und doch schon fast gewohnt. Jährlich steigen die Austrittszahlen. 2023 verließen über 500.000 Katholiken die Kirche – ein neuer Höchstwert. Die evangelischen Kirchen verzeichnen ähnliche Tendenzen. Der sonntägliche Gottesdienstbesuch ist zur Ausnahme geworden: Nur etwa 7 % der Katholiken und weniger als 5 % der Protestanten nehmen regelmäßig teil.
Besonders junge Menschen zeigen kaum noch religiöse Anschlussfähigkeit. Der Glaube verschwindet nicht mit Protest – sondern mit Desinteresse. Was bleibt, ist eine kulturelle Restreligion ohne spirituelle Tiefe, ohne lebenspraktische Bedeutung.
3. Ursachen: Differenzierung, Pluralisierung, Individualisierung
Was steckt hinter dieser Entwicklung?
Ein zentraler Faktor ist die funktionale Differenzierung moderner Gesellschaften: Aufgaben, die einst der Kirche vorbehalten waren – etwa Bildung, Ethik oder Krisenbewältigung –, werden heute durch säkulare Institutionen erfüllt. Religion ist kein strukturelles Grundelement mehr – sondern eine persönliche Wahlmöglichkeit unter vielen.
Zugleich hat sich das Leben pluralisiert: Der Sonntag ist Freizeit, der religiöse Kalender verliert an Relevanz, Rituale werden säkularisiert. Und inmitten all dessen wächst ein neuer anthropologischer Anspruch: Autonomie. Der moderne Mensch will selbst entscheiden, ob und wie er glauben möchte – autoritative Verkündigung wird als Bevormundung empfunden.
4. Drei weitverbreitete Missverständnisse
Um die Krise zu verstehen, gilt es auch, verbreitete Fehlannahmen zu korrigieren:
- Missverständnis 1: „Die Skandale sind schuld.“
Zweifellos haben Missbrauch und Vertuschung Vertrauen zerstört – doch der Rückgang begann lange vor den Skandalen. Der Bedeutungsverlust religiöser Praxis hat tiefere kulturelle Ursachen.
- Missverständnis 2: „Krisen führen zur Rückkehr des Glaubens.“
Die Realität zeigt: Die Pandemie etwa hat Isolation und psychische Belastung verstärkt – nicht das Gebet. Nur bereits religiös sozialisierte Menschen suchten vermehrt geistlichen Halt.
- Missverständnis 3: „Der Glaube wird bekämpft.“
In Wahrheit wird er vergessen. Viele sagen nicht mehr: „Ich glaube nicht an Gott“, sondern: „Ich denke nicht darüber nach.“ Diese spirituelle Indifferenz ist die tiefere Herausforderung.
- Säkularisierung: Kein Kampf, sondern Verblassen
Säkularisierung ist kein ideologischer Angriff – sie ist ein stiller Prozess des Bedeutungsverlusts. Die Kirche verliert ihren kulturellen Resonanzraum, weil sie nicht mehr selbstverständlich zum Lebensvollzug gehört. Glaube wird zur Privatangelegenheit – oder fällt ganz weg.
Entscheidend ist hier die Erosion religiöser Sozialisation: Kinder wachsen heute oft ohne Gebete, ohne Bibelgeschichten, ohne kirchliche Feste auf. Was nicht erzählt wird, wird auch nicht geglaubt. Wo keine spirituelle Sprache mehr gesprochen wird, verkümmert das religiöse Bewusstsein.
Die Folge: Der Glaube ist nicht Gegenstand von Streit – sondern Objekt des Vergessens. Gott wird nicht abgelehnt – er wird nicht mehr gesucht.
- Eine geistliche Aufgabe – nicht nur ein Strukturproblem
Die gegenwärtige Entwicklung ist nicht allein mit Reformpapieren oder Strukturveränderungen zu bewältigen. Sie verlangt eine geistliche Antwort. Denn was verloren geht, ist nicht nur Organisation – sondern Beziehung. Was schwindet, ist nicht nur Bindung – sondern Sehnsucht.
Deshalb ist die Aufgabe der Kirche nicht primär, Programme zu optimieren, sondern Präsenz zu erneuern. Nicht Management ist gefragt, sondern missionarische Demut: eine Kirche, die zuhört, mitgeht, offen bleibt für das, was der Geist Gottes in dieser Wüste neu entstehen lassen will.
Ausblick: Was bleibt – und was werden kann
Die Kirche der Zukunft wird kleiner sein – das ist wahrscheinlich. Sie wird nicht mehr die selbstverständliche Mitte sein. Aber sie kann zu einem Ort werden, an dem der leise Ruf nach Sinn, nach Gnade, nach Hoffnung wieder Gehör findet.
Sie muss nicht alles wissen – aber viel zuhören. Sie muss nicht alles kontrollieren – aber vieles mittragen. Die Frage ist nicht: Wie können wir zurück in die Mitte der Gesellschaft? Sondern: Wie können wir nahe bei den Menschen bleiben, auch wenn wir nicht mehr im Zentrum stehen?
„Offensichtlich geht es heute auch ohne Religion.“
Vielleicht. Aber die tiefere Frage bleibt:
Geht es dem Menschen wirklich gut ohne Hoffnung, ohne Transzendenz, ohne einen Gott, der bleibt?
Dort, wo Kirche diese Frage nicht beantwortet, sondern mit den Menschen gemeinsam trägt, kann sie neu glaubwürdig werden. 
Kurzbiographie von Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer: geb. 1949 in Altdorf/ Titting;1977 Priesterweihe; 1977-1985 Abtei Niederaltaich; Studien (Diplom, Lizentiat, Doktorat): Eichstätt, Jerusalem, Griechenland, Rom; 1991-1998 Pfarrseelsorge; 1998-2008 Gründungsrektor des Collegium Orientale in Eichstätt; 2002 Erzpriester-Mitrophor; 2010 Archimandrit; 2004-2012 Päpstl. Konsultor für die Ostkirchen/Rom; 2008-2015 Rektor der Wallfahrt und des Tagungshauses Habsberg; 2011-2015 Umweltbeauftragter und 2014-2017 Flüchtlingsseelsorger der Diözese Eichstätt; seit 2017 Mitarbeit in der außerordentlichen Seelsorge.
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!

Lesermeinungen| | Versusdeum 31. August 2025 | | | | "Pascal'sche Wette" und ein Teufelskreis @Moorwen Der Mathematiker Blase Pascal hat zurecht festgestellt, dass es weitaus klüger ist, ein paar Jahrzehnte zugunsten einer möglichen Ewigkeit zu opfern, als umgekehrt ("Pascal'sche Wette").
Das Problem ist, dass uns Ewigkeit, Himmel und Hölle als etwas Abstraktes erscheint, das vermeintlich weit weg ist, die Versuchungen und das bequeme Leben auf dem "breiten Weg, der zur Hölle führt" aber jetzt und konkret sind.
Wobei das Leben für uns Christen ja gar nicht so unerträglich ist und uns Freuden auch keineswegs generell versagt werden. Und wer sich ganz Gott anvertraut, lebt sicherlich glücklicher, als die meisten anderen Menschen. | 
0
| | | | | St. Hildegard 29. August 2025 | | | | @Moorwen „Not lehrt nicht mehr beten.“ weil sogar die Armen der Meinung sind, dass nicht Gott ihnen helfen muss, sondern die reichen Länder mit Hilfslieferungen.
Da haben Sie so ziemlich den Kern getroffen. Ironischerweise sind es aber vielfach auch die Kirchen, die so etwas vermitteln.
Und: Dass es im Grunde töricht ist, nicht an Gott zu glauben, nur weil man ihn nicht beweisen kann, das weist schon Blaise Pascal nach. Wenn ich so lebe, als gäbe es keinen Gott, und es gibt ihn doch - ist denn das Risiko, das ewige Heil zu verspielen, am Ende nicht viel größer?
Vielfach denken die Menschen aber: Hauptsache, erst einmal "gut gelebt" - gerade so, als würde ihnen der Glaube irgend etwas wegnehmen. | 
1
| | | | | modernchrist 26. August 2025 | | | | @Stefan fleischer Danke für das sehr schöne Gebet!
Vor allem die positive Interpretation der Gottesfurcht und was sie bewirkt. Ausdrucken und immer wieder beten.
Die Menschen heute fürchten sich vor dem Einbruch bei der Rente, von einem Krieg, vor Krankheit und was weiß ich. Gott und seine klaren Weisungen "fürchten" viele nicht. Sie scheuen sich nicht, gegen Gott ganz bewusst zu handeln und ihn bewusst zu beleidigen. | 
1
| | | | | Wirt1929 25. August 2025 | | | | Beten Erschütternde, aber auch bekannte Bestandsaufnahme. Die orientiert säkulare Lebensweise führt den im Glauben schwankenden Christen verstärkt in die Gottesferne und ermöglicht zunehmend den Schritt zum Kirchenaustritt. Ich möchte aber nicht allen Ausgetretenen den Glauben an Gott absprechen. Gott allein weiß um unsere Schwachheit und erwartet sehnlichst unsere Gebete. Bestürmen wir den Himmel. | 
0
| | | | | Stefan Fleischer 25. August 2025 | |  | So wie ich das sehe Die Kirche ist nur attraktiv, wenn sie Gemeinschaft ist. Wahrhaft Gemeinschaft aber ist sie nur, wenn sie Gemeinschaft im Glauben ist. Gemeinschaft im Glauben aber heisst, dass alle den gleichen und klar formulierten Glauben kennen und sich zu ihm bekennen. Dies wiederum heisst zuerst einmal, aus diesem Glauben zu leben, eine Beziehung zu diesem allumfassenden, dreifaltig einen Gott, unserem Herrn und Gebieter aufzubauen und zu pflegen und zwar mit jener Liebe, die mehr ist als ein gutes Gefühl, sondern eine Liebe wie sie in der Schrift beschrieben ist: «Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.» (Joh 14,21) Diese Liebe lernen wir im Gebet, z.B. in folgendem:
./. | 
1
| | | | | Stefan Fleischer 25. August 2025 | |  | Mein Herr und mein Gott Lehre mich, Herr, Deinen Willen zu tun,
denn Du bist unser Gott.
Lehre mich, Herr, Deinen Willen zu akzeptieren,
denn Du bist unser Herr.
Lehre mich, Herr, für all Deine Gaben zu danken,
denn Du bist unser Vater.
Lehre mich, Herr, Dich immer und überall zu loben,
damit ich würdig und fähig werden, Dich in alle Ewigkeit zu preisen.
Lehre mich, Herr, jene wahre Gottesfurcht,
welche sich fürchtet, Dich zu beleidigen.
Lehre mich, Herr, Dich zu lieben,
wie es Deiner unendlichen Liebe zu uns entspricht.
Lehre mich, Herr, Dir zu vertrauen,
was immer auch kommen mag.
Denn Deine Urteile sind wahr,
gerecht sind sie immer. (Ps 19,10)
Und Deine Barmherzigkeit schenkst Du allen,
die Dich fürchten. (Ps 103,13)
Amen | 
1
| | | | | Moorwen 25. August 2025 | | | | der Teufelskreis Jeder rational denkende Mensch weiß doch, dass man im Diesseits nicht überprüfen kann, ob im Jenseits (nach dem Tod) noch was kommt, oder nicht. So also müsste doch die einfache Logik und Vernunft jeden dazu bewegen, vor dem Tod dafür zu sorgen, nach dem Tod bei Gott aufgenommen zu werden, falls es doch einen Gott gibt, auch ohne Beweise für seine Existenz zu haben.
Also, allein deshalb an Gott nicht zu glauben und ihn nicht zu suchen, weil der Beweis für die Existenz Gottes fehlt, ist einfach nur töricht. Die Menschen glauben und suchen heute Gott nicht, weil sie Beweise für die Nichtexistenz Gottes haben (diese haben sie nicht), sie suchen deshalb Gott nicht, weil sie glauben sich selber zu veräppeln, falls es doch keinen Gott gibt – hier schließt sich der Teufelskreis und die Aufgabe der Kirche von heute wäre es, in ihrer Glaubensverkündigung diesen Kreis zu durchbrechen. Stattdessen versucht die Kirche sich mit der Welt immer wieder zu arrangieren. | 
0
| | | | | golden 25. August 2025 | | | | Nehmen wir auch Gott hinein in die Betrachtung: In den Himmel kommen die von Gott Erwählten.
Mit Respekt darauf sollten wir Menschen begierig danach sein,zu ihnen zu gehören.
Hochmut,Vermessenheit oder Desinteresse mögen ihre Bedingtheiten haben,eine Rechtfertigung sind diese Gemütslagen nicht. | 
0
| | | | | Fink 25. August 2025 | | | | @ chorbisch - Einverstanden ! Ein Teil der Menschen heute will gar kein ewiges Leben.
Vor der "Aufklärung" war allen Menschen klar: Nach dem Tod kommt ein "ewiges Leben", entweder ich erleide auf ewig Qualen in der Hölle, oder ich genieße die "beseeligende Anschauung Gottes" im Himmel.
Heute aber: "Wer weiß, ob da überhaupt was kommt...wahrscheinlich ist alles vorbei..."
Also, diesen Teil der Menschen erreichen wir mit der christlichen Botschaft nicht. Um so mehr sollten wir uns um die anderen kümmern. | 
1
| | | | | chorbisch 25. August 2025 | | | | @ Fink Haben Sie in Erwägung gezogen, dass manche Menschen gar kein Ewiges Leben wollen?
Sie waren zufrieden mit ihrem Leben, es ging ihnen gut, Katastrophen, wie Kriege, Naturkatastrophen usw. bleiben ihnen erspart und sie konnten das Leben genießen, ohne sich dabei permanent in Sünden zu wälzen oder ihren Mitmenschen bewusst Schaden zuzufügen. Ganz normale Menschen.
Und sie sind zufrieden mit dem Gedanken, friedlich und für immer einschlafen zu können, und dass es dann "vorbei" ist.
Andere, deren Leben von Not und Krankheit geprägt war, sind auch froh, wenn es endlich vorbei ist und haben auch keine Sehnsucht nach einem ewigen Leben bei einem Gott, der sie aus ihrer Sicht mit ihrer Not allein gelassen hat.
Und mit Formulierungen, wie im Beitrag von @gebsy dürfte man diese Menschen wohl nicht erreichen, von einem Sinneswandel ganz zu schweigen. | 
1
| | | | | Richelius 25. August 2025 | | | |
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir bis jetzt noch keine echte Not hatten. Corona war vielleicht ein Hauch davon. | 
3
| | | | | ottokar 25. August 2025 | | | | Herr Thiermeyer spricht nur für Europa Denn weltweit nimmt die Zahl der Katholiken grundsätzlich zu und echter, tiefer Glaube findet sich fern von uns , in Afrika , Südamerika und Asien , durchaus in Regionen , die weitaus ärmer sind als wir, wo Not herrscht.Selbst in Nordamerika wächst der Glaube. In vielen Teilen Afrikas nehmen am Sonntagsgottesdienst oft an die Tausend Gläubige teil, die oft stundenlange Fußmärsche zurück legen, um an einer heiligen Messe teilzunehmen. Also pessimistisch müssen wir hauptsächlich für große Teile unseres Europa sein . | 
1
| | | | | gebsy 25. August 2025 | |  | Demut Gottes "Gott wird nicht abgelehnt – er wird nicht mehr gesucht."
Ein unmöglicher Versuch:
Gottes Demut und Mitleiden angesichts der Selbstgenügsamkeit SEINER Geschöpfe ist Liebesschmerz von unvorstellbarem Ausmaß ...
DI Hubert Liebherr durfte die Liebesreue erfahren www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=hubert%20Liebherr%20erfahrungen&mid=7B74FEDEE6220CC397277B74FEDEE6220CC39727&ajaxhist=0 | 
0
| | | | | Moorwen 25. August 2025 | | | | „Not lehrt beten.“ 1) „Not lehrt nicht mehr beten.“ weil sogar die Armen der Meinung sind, dass nicht Gott ihnen helfen muss, sondern die reichen Länder mit Hilfslieferungen.
2) Beziehen sich diese Angaben auf die gesamte Weltkirche, oder interessieren wir uns wieder nur für das Schicksal des deutschen Volkes (wie in den 30-er Jahren)?
3) Die Ursachen sind auch: die nichtssagenden Predigten der Kleriker und die links-grüne Mentalität des Klerus, der mehr um die Rechtsstaatlichkeit besorgt ist, als um die Glaubensverkündigung und die Kirche.
4) - Missverständnis 3: „Ich denke nicht darüber nach.“
Damit wollen viele ihre Souveränität und spirituelle Reife bezeugen. In Wahrheit aber treffen sie ihre Entscheidungen nicht selber und nicht souverän, sondern das Smartphon, der Fernseher, TikTok, Facebook & Co. treffen die Entscheidungen für sie. | 
2
| | | | | Fink 25. August 2025 | | | | Die Gottvergessenheit unserer Zeit erlebe ich besonders bei den Todesanzeigen und Bestattungszeremonien. Da ist vielfach keine Hoffnung auf ein ewiges Leben im Himmel bei Gott.
Vor 250 Jahren, im Zeitalter der "Aufklärung", hat es angefangen. Jetzt haben wir sozusagen die Talsohle erreicht.
Für gläubige Christen gilt es, unter den Menschen diejenigen zu erkennen, die für die Gottesfrage offen sind, und diese dann mit der "Vollkost" des geoffenbarten christlich-Katholischen Glaubens zu versorgen. | 
3
| | |
Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder.
kath.net verweist in dem Zusammenhang auch an das Schreiben von Papst Benedikt zum 45. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel und lädt die Kommentatoren dazu ein, sich daran zu orientieren: "Das Evangelium durch die neuen Medien mitzuteilen bedeutet nicht nur, ausgesprochen religiöse Inhalte auf die Plattformen der verschiedenen Medien zu setzen, sondern auch im eigenen digitalen Profil und Kommunikationsstil konsequent Zeugnis abzulegen hinsichtlich Entscheidungen, Präferenzen und Urteilen, die zutiefst mit dem Evangelium übereinstimmen, auch wenn nicht explizit davon gesprochen wird." (www.kath.net)
kath.net behält sich vor, Kommentare, welche strafrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen, zu entfernen. Die Benutzer können diesfalls keine Ansprüche stellen. Aus Zeitgründen kann über die Moderation von User-Kommentaren keine Korrespondenz geführt werden. Weiters behält sich kath.net vor, strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. | 
Mehr zu | 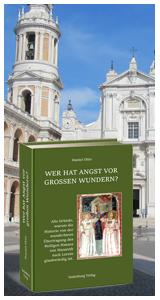





Top-15meist-gelesen- Oktober 2025 mit kath.net in MEDJUGORJE mit P. Leo MAASBURG
- R.I.P. Charlie Kirk - Ein Attentat erschüttert die USA
- „Er war aber auch ein Hetzer“. Über ein wiederkehrendes Argument zum Mord an Charlie Kirk
- Drei Nonnen für ein Halleluja
- Feminismus, Queer-Kultur – Wer ist die neue Präsidentin der Päpstlichen Akademie für die Künste?
- Deutscher ZDF-Korrespondent Theveßen steht vor dem Rauswurf aus den USA
- Vatikan sieht die Welt "am Rand des Abgrunds"
- Die Gender-Sprachpolizei des Bistums Limburg macht mobil
- Leo XIV.: 'Demokratie nicht notwendigerweise die beste Lösung für alles.'
- Mordfall Charlie Kirk: Transgender-Parolen und antifaschistische Sprüche auf Patronen
- USA verhängen Einreisesperre für ausländische Charlie-Kirk-Mord-Jubler!
- Bischof Bätzing meint: Regenbogenflagge am Reichstag ‚wäre ein gutes Zeichen gewesen‘
- Papst betet für Familie des ermordeten Charlie Kirk
- „Ich liebe euch! Geht zur Messe!“
- Bischof Barron über Charlie Kirk: Er war ‚in erster Linie ein leidenschaftlicher Christ‘
|