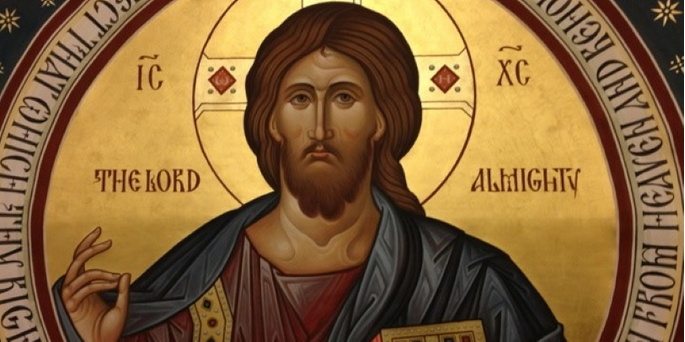SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln: 



Top-15meist-diskutiert- Papst an Ministranten: Denkt über Priesterberuf nach
- USA werden im Jahr 2100 ein katholisches Land sein
- Ist der Begriff „Neger“ mit dem des „parasitären Zellhaufens“ verfassungsrechtlich vergleichbar?
- Papst Leo an Politiker: Man kann nicht katholisch sein und gleichzeitig für Abtreibung sein
- Dokumentationsstelle: Islamistischer Einfluss in Österreich nimmt zu
- Der deutsch-synodale Irrweg möchte Kritiker zum Schweigen bringen
- Papst Leo XIV. betet für die Opfer des Attentats auf eine katholische US-Schule
- Theologen: Konzil von Nizäa nach 1.700 Jahren weiter aktuell
- Den tradierten Glauben demütig anbieten
- Sozialethiker Rhonheimer: Jesus war kein Kapitalismuskritiker
- Weißes Haus: FBI untersucht auf „Inlandsterrorismus und Hasskriminalität gegen Katholiken“
- "Ohne ihr heldenhaftes Handeln hätte es deutlich schlimmer kommen können"
- US-Erzdiözese Denver: Pfarreien nominieren 900 junge Männer für das Priestertum
- Wir sind hier, um der Welt zu erklären, dass auch Wladimir Putin für seine Verbrechen bezahlen muss"
- Australien wirf Iran Steuerung von antisemitischen Terroranschlägen vor
| 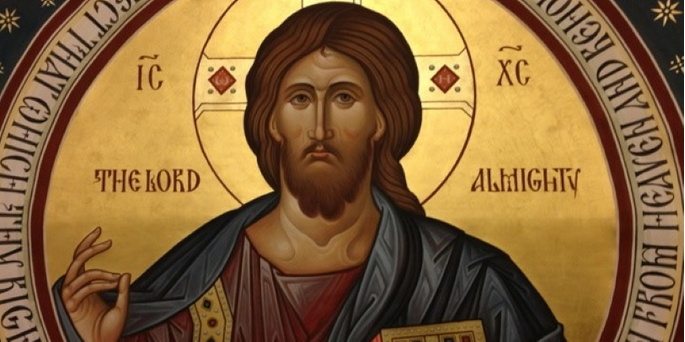
Theologen: Konzil von Nizäa nach 1.700 Jahren weiter aktuellvor 31 Stunden in Chronik, 9 Lesermeinungen
Druckansicht | Artikel versenden | Tippfehler melden
Theologische Sommerakademie in Aigen diskutierte Ursprung und heutige Bedeutung des christlichen Glaubensbekenntnisses.
Linz (kath.net/ KAP)
Im Zeichen des heuer vor 1.700 Jahren stattgefundenen Konzils von Nizäa (Nicäa) ist die 35. Internationale Theologische Sommerakademie in Aigen (Bezirk Rohrbach) gestanden, die am Mittwoch zu Ende gegangen ist. Unter dem Leitgedanken "Christus ist Sieger. Nizäa 325 - Christkönig 1925 - Heiliges Jahr 2025" analysierten deutschsprachige Theologen laut Berichten des Portals "CNA Deutsch" die Bedeutung des ersten ökumenischen Konzils der Christenheit für die Gegenwart. Dabei ging es neben historischen Rückblicken auch um aktuelle Standortbestimmung angesichts wachsender religiöser Unschärfen.
Der Kölner Dogmatiker Prof. Manuel Schlögl hob den in Nizäa festgeschriebenen, entscheidenden Unterschied des Christentums zu anderen Religionen hervor: "Das göttliche Wort ist nicht in einer einmaligen Sprache oder gar in einem Buch enthalten, sondern ist Person geworden." Mit diesem Glaubenssatz sei eine theologische Zäsur markiert worden. Weder das Kultbild wie im alten Orient noch die Schrift wie im Judentum vermittle demnach die göttliche Gegenwart, sondern "das Fleisch des menschgewordenen Gottessohnes". Diese "Inkarnation des göttlichen Logos" sei das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens.
Schlögl erläuterte weiter, dass die Konzilsformel "eines Wesens mit dem Vater" im Licht des Neuen Testaments zu verstehen sei: Sie spreche von einem Gott, dessen Wesen barmherzige und erlösende Liebe ist. Das Konzil habe damit nicht nur eine dogmatische Lehrfrage entschieden, sondern der Kirche ihre eigene Sendung vergegenwärtigt: Sie sei berufen, diese göttliche Liebe durch die Nachfolge Christi glaubwürdig zu bezeugen. Die Entscheidung von 325 n. Chr. sei insofern nicht bloße Abgrenzung, sondern Ausdruck geistlicher Selbstvergewisserung gewesen.
Auch mit Blick auf die Gegenwart regte Schlögl eine stärkere liturgische und pastorale Präsenz des Konzils an. Das Nizänische Glaubensbekenntnis sei das einzige Bekenntnis, das alle christlichen Konfessionen verbinde. Ein "Sonntag der Konzilsväter" oder auch die häufigere Verwendung des sogenannten "Großen Glaubensbekenntnisses" könne helfen, dieses gemeinsame Fundament wieder bewusster zu machen, riet der Dogmatiker. Das kirchliche Amt sei in diesem Zusammenhang nicht als Hemmnis, sondern als "Gewähr solcher Einheit" zu verstehen. 
Infragegestellte göttliche Person
Der Wirkungsgeschichte des Konzils und der schleichenden Erosion seiner theologischen Grundbegriffe war der Vortrag des Augsburger Dogmatikers Prof. Thomas Marschler gewidmet. Zwar sei Nizäa für ihn "eines der wichtigsten Dokumente christlicher Theologie überhaupt", doch mit der Aufklärung habe sich das Verständnis von Christus als ewigem Sohn Gottes in vielen theologischen Schulen verflüchtigt. Besonders in der protestantischen Universitätstheologie des 18. Jahrhunderts sei anti-nizänisches Denken zunehmend salonfähig geworden - zunächst unter dem Einfluss historisch-kritischer Bibellektüre, später durch die systematische Infragestellung der Trinitätslehre.
Auch in der katholischen Theologie habe sich diese Entwicklung bemerkbar gemacht, etwa in den Christologien von Hans Küng oder Karl-Josef Kuschel. Letzterer habe die These vertreten, dass die Präexistenz Jesu im Neuen Testament "keine zentrale Funktion" habe und für den heutigen Glauben verzichtbar sei. Dem widersprach Marschler entschieden: "Wenn Gott sich uns im Menschen Jesus von Nazareth selbst zeigt und mitteilt, dann muss Jesus eine göttliche Person sein - sonst handelt es sich nicht um Selbstoffenbarung Gottes."
Dabei sei die Formel von der Wesensgleichheit ("homoousios") kein fremder griechischer Import, sondern Ausdruck des christlichen Monotheismus, der Einheit und Beziehung in Gott zugleich denkt. Marschler erinnerte an Joseph Ratzingers Deutung, dass mit Nizäa das göttliche Eine nur noch im Modus der Beziehung gedacht werden könne - für antikes Denken ein "unerhörter" Gedanke. Die Konzilsentscheidung sei daher mehr als historische Dogmatik: Sie sei Ausdruck der christlichen Grundüberzeugung, dass nur ein wirklich göttlicher Christus auch wirklich erlösen könne.
Synodalität als Stärkung der Einheit
Der Kirchenhistoriker P. Martin Mayerhofer von der Hochschule Heiligenkreuz warf schließlich einen Blick auf die politische und kirchengeschichtliche Dimension des Konzils. Dass die Kirchenversammlung damals von Kaiser Konstantin einberufen wurde und ohne persönliche Anwesenheit des Papstes stattfand, wertete der Ordensmann aus der Geistlichen Familie "Das Werk" nicht als Mangel, sondern als Zeichen einer "synodal organisierten Kirche" der frühen Jahrhunderte. Gültigkeit habe das Konzil dennoch erst durch die nachträgliche Anerkennung durch den römischen Bischof erlangt.
Der Streit zwischen dem alexandrinischen Priester Arius und den übrigen Konzilsvätern habe eine Grundfrage berührt: Ist Jesus Christus wirklich göttlich oder nur ein besonders begnadeter Mensch? Um diesen Streit zu klären, habe das Konzil den Begriff homoousios gewählt - "zwar bibelfremd, aber theologisch eindeutig". Damit sei deutlich geworden, dass Christus nicht ein Geschöpf, sondern wesensgleich mit dem Vater ist. Arius wurde exkommuniziert, seine Lehre mit dem Anathem belegt.
Mayerhofer betonte, dass das Konzil nicht nur eine theologische Klärung bewirkt, sondern auch Strukturen geschaffen habe: Es ordnete regelmäßige regionale Bischofssynoden an und stärkte damit die Einheit der Kirche. "Das Glaubensverständnis kann nicht willkürlicher Auslegung Einzelner unterworfen sein", so der Kirchenhistoriker. Das Konzil von Nizäa habe auch für heutige Reformdiskussionen beispielhaft gezeigt, wie die Kirche gemeinsam unter Bezugnahme auf den Heiligen Geist zu tragfähigen Glaubensentscheidungen komme.
Copyright 2025 Katholische Presseagentur KATHPRESS, Wien, Österreich (www.kathpress.at) Alle Rechte vorbehalten
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!

Lesermeinungen| | Moorwen vor 38 Minuten | | | | @ SalvatoreMio Bitte im Video ab Minute 5:15 aufmerksam zuhören und schauen – s. Link: www.youtube.com/watch?v=spJUcSNTtr0 | 
0
| | | | | SalvatoreMio vor 1 Stunden | | | | Stundengebet bei Kaffee und Keks? Lieber@Moorwen! Das zu glauben, fällt schwer, doch da fällt mir nach Jahrzehnten die Pastoralreferentin wieder ein, die bei einer Bibelreflexion in kleinerem Kreis keine Scheu hatte, Kaugummi zu kauen. | 
0
| | | | | Moorwen vor 5 Stunden | | | | @ Stefan Fleischer Ja, dem stimme ich auch zu – vor allem dem, „dass ein Grossteil der modernen Christen religiöse Analphabeten sind.“ Aber nach jahrelanger Beobachtung des Verhaltens der Laien, nach vielen Gesprächen mit Laien und Priestern muss man zwangsläufig feststellen: Die Seminaristen werden in deutschen Priesterseminaren nicht zu Priestern (auch spätere Bischöfe) geformt, sondern, wenn sie die Prüfungen im Studium bestehen, werden sie geweiht – dabei spielt es mittlerweile keine Rolle mehr, ob schwul, hetero oder noch was anderes. Am Ende werden hl .Messen liederlich von Chaoten gefeiert – die Klugen schweigen dazu und die religiösen Analphabeten sagen, dass das so sein muss. | 
0
| | | | | Moorwen vor 6 Stunden | | | |
Da die meisten Messbesucher Mittläufer sind, interessiert es sie nicht, ob sie das große Credo beten oder nicht, oder ob der Priester „für viele“ spricht und nicht „für alle“… dennoch ändert sich in D nichts! Noch bis in die 2000-er Jahre wurde in der hl. Messe in den meisten Kirchen in D nur eine Lesung vor dem Evangelium vorgetragen (wie in der „Alten Messe“), obwohl die Liturgiereform 2 Lesungen vorsieht. Also, 55 Jahre nach V2 haben die Deutschen immer noch nicht gelernt, wie man die hl. Messe (NOM) feiert. Unsere Seminaristen werden nicht zu Priester ausgebildet und geformt, sie werden zu willenlosen Moderatoren herangezüchtet, die ihr Stundengebet bei Kaffee und Keksen in ihren Zimmern zu zweit beten dürfen – habe selber vor 3 Jahren in einer Dokumentation über die Ausbildung der Priester im Bistum Köln gesehen. Sie haben die Bibel, den CIC und KKK vielleicht in der Hand gehabt, aber nie gelesen. Mehr muss man dazu nicht sagen. Neuevangelisierung geht anders. | 
1
| | | | | Versusdeum vor 9 Stunden | | | | @Stefan Fleischer Volle Zustimmung, aber soll der letzte Halbsatz wirklich lauten "... ist keine christliche Kirche" Oder vielmehr "... ist nicht mehr die vom Herrn gegründete und von Ihm selbst klar vorgezeichnete katholische Kirche"? | 
0
| | | | | Stefan Fleischer vor 10 Stunden | |  | @ Moorwen Mir ist noch ein anderer Grund eingefallen. Das grosse Glaubensbekenntnis ist sozusagen in der Sprache unseres Glaubens geschrieben, selbst dort, wo es in der Volkssprache gebetet wird. Diese Sprache des Glaubens mit ihren klar definierten Begriffen ist (zusammen mit dem Latein als Kirchensprache?) weitgehend verloren gegangen. Parallel dazu hat sich die Volkssprache zu einer Sprache entwickelt, in welcher die Begriffe immer mehr relativ werden, immer mehr mehrere Definitionen haben, welche sich teilweise sogar widersprechen. So erreicht man zwar mehr Leute, doch man zerstört damit die Gemeinschaft im Glauben. Eine Kirche aber, die nicht Gemeinschaft im Glauben ist, selbst wenn sie Gemeinschaft im Tun wäre, ist keine christliche Kirche. | 
2
| | | | | Moorwen vor 16 Stunden | | | | das große Credo Eintrag aus deutschem Messbuch für die Gemeindemesse an Sonn- und Feiertagen:
- „Das Große Glaubensbekenntnis soll im Regelfall in seinem Wortlaut gesprochen werden. Ausnahmsweise darf es durch ein Credo-Lied ersetzt werden.“
- „Anstelle des Großen Glaubensbekenntnisses kann das Apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen werden“.
Also, in Deutschland haben wir jeden Sonn- und Feiertag eine Ausnahmesituation - wir feiern immer die hl. Messe nicht so, wie wir müssen/sollen, sondern so, wie wir ausnahmsweise dürfen.
Wenn man einfach die Nr. 586 aus dem neuen Gotteslob auf der Wand einblenden lässt, beten die Leute das Große Credo ohne sich danach zu beklagen, weil das ihnen eh egal ist. So könnte man die Messebesucher dazu „erziehen“, an jedem Sonntag das Große Glaubensbekenntnis zu beten. Warum tut man das nicht? – Weil sich die Deutschen von anderen (Vatikan) nicht sagen lassen, wie sie die hl. Messe feiern müssen. Das Selbstbestimmungsgesetz wurde wohl schon früher erfunden. ;-) | 
2
| | | | | SalvatoreMio vor 23 Stunden | | | | Das Nizänische Glaubensbekenntnis @Stefan Fleischer: es gibt verschiedene Gründe, warum es nicht gebetet wird! Ein simpler Grund: es dauert etwas länger! Damit verbunden ist oftmals der Unwille von Gläubigen, denn die hl. Messe soll schnell erledigt sein. Ein Beispiel: vor einigen Wochen war ein Hochfest mit Gloria und Credo, werktags. Ich fragte einen Priester an, wie es wohl zelebriert würde. Antwort: "Ich zelebriere nicht, aber '...' Der wird es wohl festlich und ausführlich machen". So war es dann auch: wunderschön! Es war abends; keine beängstigende Dunkelheit; Anwesende: einige Rentner. Doch anschl. ging es los: "Warum muss die Messe so lange dauern? Alles übertrieben!"Ich wetterte zurück und erklärte Bekannten, weshalb diese Liturgie so wichtig gewesen sei. - Leider sind manche Priester nicht fähig, Glaubensgeheimnisse volksnah zu erklären, und Gläubige wiederum sind ungeduldig und nicht lernbereit. (Der Fernseher zuhause wartet auch schon!). Das ist die Wirklichkeit! | 
2
| | | | | Stefan Fleischer vor 29 Stunden | |  | Das Nizänische Glaubensbekenntnis «Das Nizänische Glaubensbekenntnis sei das einzige Bekenntnis, das alle christlichen Konfessionen verbinde. Ein "Sonntag der Konzilsväter" oder auch die häufigere Verwendung des sogenannten "Großen Glaubensbekenntnisses" könne helfen, dieses gemeinsame Fundament wieder bewusster zu machen, riet der Dogmatiker.»
Mir scheint, dass auch dieser dringliche Appell wiederum ungehört verhallen wird. Irgendwie scheint dieses Glaubensbekenntnis vielen unserer Hirten, nicht mehr in den Kram zu passen. Als theologischer Laie will ich mich zur dort formulierten Lehre nicht äussern. Aber ist es nicht symptomatisch, wie heute damit umgegangen wird? Wie alles, was schwer zu verstehen und schwierig zu erklären ist, um das wird ein grosser Bogen gemacht. Und dann wundert man sich, dass ein Grossteil der modernen Christen religiöse Analphabeten sind. Neuevangelisation geht anders. | 
3
| | |
Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder.
kath.net verweist in dem Zusammenhang auch an das Schreiben von Papst Benedikt zum 45. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel und lädt die Kommentatoren dazu ein, sich daran zu orientieren: "Das Evangelium durch die neuen Medien mitzuteilen bedeutet nicht nur, ausgesprochen religiöse Inhalte auf die Plattformen der verschiedenen Medien zu setzen, sondern auch im eigenen digitalen Profil und Kommunikationsstil konsequent Zeugnis abzulegen hinsichtlich Entscheidungen, Präferenzen und Urteilen, die zutiefst mit dem Evangelium übereinstimmen, auch wenn nicht explizit davon gesprochen wird." (www.kath.net)
kath.net behält sich vor, Kommentare, welche strafrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen, zu entfernen. Die Benutzer können diesfalls keine Ansprüche stellen. Aus Zeitgründen kann über die Moderation von User-Kommentaren keine Korrespondenz geführt werden. Weiters behält sich kath.net vor, strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. | 
Mehr zu | 





Top-15meist-gelesen- Sommerspende für kath.net - Bitte helfen SIE uns jetzt JETZT!
- Oktober 2025 mit kath.net in MEDJUGORJE mit P. Leo MAASBURG
- Papst Leo an Politiker: Man kann nicht katholisch sein und gleichzeitig für Abtreibung sein
- Papst Leo XIV. betet für die Opfer des Attentats auf eine katholische US-Schule
- Papst an Ministranten: Denkt über Priesterberuf nach
- USA: Dominican Sisters of St. Cecilia heißen dieses Jahr 21 Postulantinnen willkommen
- Ist der Begriff „Neger“ mit dem des „parasitären Zellhaufens“ verfassungsrechtlich vergleichbar?
- US-Erzdiözese Denver: Pfarreien nominieren 900 junge Männer für das Priestertum
- Der deutsch-synodale Irrweg möchte Kritiker zum Schweigen bringen
- Polen: Tschenstochau feiert "Schwarze Madonna" mit Friedensappell
- Ökumenische Begegnungen zwischen Rom und Konstantinopel
- 'Alles, was künftig geschehen soll, ist für Gott bereits geschehen'
- "Ohne ihr heldenhaftes Handeln hätte es deutlich schlimmer kommen können"
- USA werden im Jahr 2100 ein katholisches Land sein
- "Als ich mich nach einer regelmäßigeren Teilnahme an der Eucharistie sehnte ..."
|