 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Der Widerhall der Geschichte im südlichen Limousin – die romanische Kirche St. Pierre in Cussac3. Oktober 2025 in Chronik, keine Lesermeinung "Seit dem XII. Jahrhundert steht die Kirche nun schon im Zentrum von Cussac. Als wir die Kirche betraten, umfing uns das Zwielicht eines geweihten Raumes, das die Distanz zu Gott geringer werden lässt." Von Lothar C. Rilinger Cussac (kath.net) Im südlichen Limousin führt uns der Weg nach Cussac, das – auf einem Hügel liegend – schon von weitem zu sehen ist. Eng umschließen die Häuser die Kirche, immer näher ist der Ort an das Gotteshaus herangerückt, immer näher lehnten sich die Lebenden an die Kirche an, jegliche Distanz wurde aufgegeben, und so verdrängten sie die Toten, die jahrhundertelang um die Kirche herum begraben waren, aus dem Orte. Ursprünglich waren sie direkt neben der Kirche in die Erde gesenkt worden, in geweihte Erde, und mit dieser Erde wurden sie dann auch bedeckt. Die Toten sollten in alten Zeiten nicht aus dem Leben der Gemeinde herausdifferenziert werden, auch als Tote waren sie noch immer Teil der Gemeinschaft, die in das Gebet der Lebenden eingeschlossen werden sollten. Und die Lebenden sahen in den Gräbern das Symbol der Vergänglichkeit, die Grabkreuze mahnten die Gläubigen daran, dass der Mensch nur als ein gehetzter und unruhiger Gast auf dieser Erde wandelt, bevor dann seiner unsterblichen Seele die Nähe zu Gott geschenkt wird. Vor langer Zeit wurde dieser alte Friedhof aufgelöst und nur noch ein Renaissance-Kreuz, das neben dem Haupteingang der Kirche angebracht ist, erinnert daran, dass einmal die Kirche Mittelpunkt des Gottesackers gewesen ist – eine letzte Erinnerung an den Wunsch der Menschen aus dem Mittelalter, nahe bei den verstorbenen Vorfahren zu sein und sie immer wieder als Teil des eigenen Lebens zu begreifen. Wir schritten über den Kirchhof und betraten die dem Heiligen Petrus geweihte Kirche, in der sich in doch etwas ungewohnter Weise die Gläubigkeit und das Geschichtsbewusstsein des Vertreters der staatlichen Gewalt, die ja schließlich Eigentümerin des Kirchengebäudes ist, zeigt. Der Bürgermeister von Cussac ist tief in der kulturellen und auch in der religiösen Tradition dieses Ortes und dieser Gegend verwurzelt, und er als rechtlicher Hausherr sah es als seine Aufgabe an, dieser Kirche nicht das Schicksal angedeihen zu lassen, das vielen romanischen Kirchen in dieser Gegend zuteil geworden ist. Er verwirklichte seine religiösen Vorstellungen, und dies mutet dem Betrachter, der aus einem Lande kommt, das zwar auch den Laizismus kennt, in dem aber, basierend auf der Weimarer Reichsverfassung, durch das grundgesetzlich abgesicherte Staatskirchenrecht das Nebeneinander von Staat und Kirche zum Vorteil beider Institutionen geregelt ist, nahezu unwirklich an. Für diesen Betrachter wirkt es schon fremdartig, wenn ein Bürgermeister bestimmt, wie eine Kirche auszusehen hat, ob sie renoviert, wie sie eingerichtet wird. Auch für uns hört die staatliche Gewalt nicht an der Türschwelle der Kirche auf, sie ist aber gleichwohl eingeschränkt, was ja immer wieder deutlich wird – gerade dann, wenn Kirchenasyl gewährt wird, was zwar nicht legitim ist, aber vom Staat (noch?) geduldet wird. In Frankreich jedoch hat der Staat auch in der Kirche sein volles Recht. In diesem Raum sind der Priester und die Gläubigen nur Gäste des Staates – Gäste in einem fremden Haus, das ihnen vor über 100 Jahren genommen worden ist. Das Schicksal fast aller französischen Kirchen steht und fällt mit der Einstellung der öffentlichen Verwaltung. Ist sie atheistisch oder auch nur agnostisch und ist sie dann auch noch arm, dann müssen die Kirchen einen Dornröschenschlaf halten, und sie umweht nur noch die Wehmut des Vergessens. Ist die Verwaltung aber dem Glauben und der religiösen Tradition verpflichtet, dann erstrahlen diese alten Bauwerke in einem Glanze, der uns den Schimmel und Staub so mancher vergessenen romanischen Kirche vergessen lässt, so ungewohnt erscheint er uns hier die Gepflegtheit. Seit dem XII. Jahrhundert steht die Kirche nun schon im Zentrum von Cussac. Ursprünglich war sie Teil der Seelsorge, die von der nahegelegenen Abtei von Boubon ausging. Von diesem Kloster sind nur noch spärliche Überreste vorhanden. Nach der Revolution 1789 wurde dieses Kloster aufgehoben, und die Gebäude wurden zum Steinbruch, aus dem sich die Anwohner reichlich bedienten. Nur schwer waren die Überreste dieses einst so bedeutenden Klosters zu finden. Als wir den südlich von Cussac in einer Senke liegenden Ort betraten, sahen wir nur die aus Feldsteinen errichteten Häuser und landwirtschaftlichen Gebäude. Kühe grasten auf den zwischen den Häusern liegenden Wiesen, Hühner pickten am Wegesrand und Tauben flogen einen Taubenschlag an. Es schien, als wenn jegliches Zeugnis an die monastische Vergangenheit, die ja immerhin viele Jahrhunderte währte, getilgt worden wäre. Nur am Grund der Senke erstreckte sich ein kleiner Weiher, in dessen glasklarem Wasser wir Fische erkannten. Nirgends eine Staumauer, und da wussten wir, dass es sich um einen natürlichen Teich handeln musste und damit um den Teich, den die Mönche nutzten, um sich mit Nahrung für die fleischlosen Freitage und die Fastenzeit zu versorgen. Das Dorf schien wie ausgestorben und erst nach längerem Suchen stießen wir im direkt am Teich gelegenen Haus auf Engländer, die uns begeistert berichteten, dass wir uns auf dem Boden des alten Klosters befänden. Stolz wiesen sie auf ihre große, ungewöhnlich lange grange, die nur durch eine kleine Straße von dem Wohnhause getrennt ist. Dies sei die alte Kirche, in der die Zisterzienser einst gebetet hätten, dort sei der Mittelpunkt des Klosters gewesen. Verblüfft schauten wir auf die Scheune, die uns schon vorher ob ihres schlechten Zustandes und ob ihrer offenen Ostmauer aufgefallen war. Wir könnten die Scheune besichtigen, einige Erinnerungen an die ursprüngliche Nutzung fänden wir noch, und mit dieser Empfehlung wandten wir uns der ehemaligen Kirche zu, ohne nicht aber vorher von dem Sohn des Hauses einen Stecken zu erhalten, damit wir die angriffslustigen Gänse, die mit einem ohrenbetäubenden Lärm den Eindringlingen den Weg verlegen wollten, abwehren konnten. Begeistert zeigte er uns noch eine uralte Marienfigur, die auf der Südseite des ehemaligen Kirchenschiffes angebracht war. Sie seien schon oft gefragt worden, ob sie diese Marienfigur nicht verkaufen wollten, damit sie in einer Kirche Platz fände, doch auch die neuen Besitzer dieses landwirtschaftlichen Betriebes haben Sinn für Tradition und möchten nicht, dass diese ehemalige Kirche eine weitere Erinnerung an ihre ursprüngliche Nutzung verliert. Mitten auf der langgestreckten, aber doch recht niedrigen, halb verfallenen Südseite der ehemaligen Kirche ist diese Marienfigur mit dem Jesuskind in die Steine eingelassen worden. Wie ein Fremdkörper wirkt dieses Signum einer marianischen Verehrung in der profanen, nur noch der Landwirtschaft dienenden Umgebung. Diese Figur ist das einzige Sakrale inmitten von Betriebsamkeit, Zerfall und Vergessenheit. Die Zeit hat die Gesichtszüge der Maria und des Kindes grob werden lassen, jedes Feine hat die Witterung im Laufe der Jahrhunderte glattgeschliffen, und doch war noch die Verehrung zu spüren, die dieser Figur entgegengebracht worden war. Als wir durch die fehlende Ostwand den Raum betraten, da erfasste uns nicht der genius loci, nichts Sakrales war mehr zu spüren, geschweige denn zu sehen. Nur landwirtschaftliche Geräte, Schrott, ein altes Bettgestell und Kunststeine, um später einmal die fehlenden Mauerteile zu ersetzen. Links auf der Südwand entdeckten wir eine kleine Nische, in der wohl früher ein Weihwasserbecken gestanden haben mag, und dann am westlichen Ende dieses Raumes einen Haufen von Steinen. Als wir uns diesen Steinen näherten, da waren wir doch überrascht. Wir fanden Reste von filigranen Steinmetzarbeiten, Ornamente, Abrundungen, Einkehlungen, alles Steine, die einmal einem Kunstwerk seine Form und seine Schönheit gaben. Als wir dann wieder aus dieser zugigen Halle traten und nach weiteren Spuren der untergegangenen Vergangenheit suchten, da stießen wir, unter dichtem Efeu verborgen und von außen kaum erkenntlich, auf Reste eines Stützpfeilers, der die Ostseite nach Norden hin verstärkte. Wie durch ein Wunder hat sich dieser rudimentäre Pfeiler erhalten, und er gibt Zeugnis von der einstigen Idee, die Grundlage war, um dieses Haus zu errichten; er ist das letzte architektonische Zeugnis, das an die große Vergangenheit anschließt und die dieses Gebäude über all' die anderen Scheunen der Gegend erhebt. Nicht die Muttergottes, die wir hier schon des Öfteren an Wohnhäusern sahen, zeugt von der einstigen Aufgabe dieses Baues, nur dieser letzte Rest des Stützpfeilers. Er zeigt den Unterschied zwischen einer grange und einer Kirche an, an ihn haftet sich die Erinnerung an die Gebete, die in dieser Kirche gesprochen worden sind und durch ihn – nur durch ihn – hatten wir Zugang zu der Vergangenheit dieses Ortes, über die die Zeit hinweggegangen ist. Doch zwanzig Jahre später hat der gläubige Brite den landwirtschaftlichen Betrieb an einen neuen Eigentümer verkauft. Dieser war bereit, sich von der Madonna zu trennen und hat sie im Jahr 2020 der Kirche in Cussac übertragen. Dort steht sie nun, gesichert durch eine starke Glasscheibe, in einer Mauernische im hinteren Teil des Kirchenschiffs. Von der Höhe in der Mauer der verfallenden alten Klosterkirche, kaum sichtbar für den nach Spuren des christlichen Frankreichs suchenden Gläubigen, ist sie gleichsam hinabgestiegen, um sich bewundern lassen zu können. Ganz weiß ist sie und ganz verwittert. Kaum ist noch ihr Gesicht zu erkennen. Doch sie hat die schändenden Horden der Revolution überstanden, nichts taten diese ihr zu Leide, keine Spuren von Gewalt sind vorhanden. Die hohe Einlassung in der Außenmauer der Klosterkirche hat sie davor bewahrt, auch den Preis zu zahlen, den die Kirchen Frankreichs in der Revolution zu zahlen hatten. Mit dieser Madonna nahm eine monastische Tradition, die viele Jahrhunderte der Bevölkerung ihren Halt gegeben hat, wieder Einzug in die Kirche in Cussac. Ein Kreis hat sich geschlossen, der über 230 Jahre aufgehoben war – eine Verbindung, die das Leben der Gläubigen so lange bestimmt hat. Damals wurde dieses Kloster von der Abtei Fontevrault gegründet - von dem Kloster, in dem die Mutter von Richard Löwenherz am liebsten betete und in dem dieser selbst seine letzte Ruhe fand. Was früher ein Ort der Verehrung war, ist nunmehr zu einem landwirtschaftlichen Regenschutz und zu einer Abstellkammer verkommen. Es ist ein Ort, an dem selbst Gott nicht mehr zu Hause zu sein scheint. Doch wieder zurück zur Kirche von Cussac: Vor 900 Jahren wurde sie gebaut – was für eine lange Zeit. Und doch stellt sich diese Zeitspanne nur als ein kurzer Abschnitt in der langen Geschichte Cussacs dar. Diese reicht weit in die vorchristliche Zeit zurück. Schon im Neolithikum, also in der Zeit zwischen 6000 und 2000 vor Christus, wurden die ersten Zeugnisse menschlicher Besiedlung wahrgenommen. Auf diesem uralten Kulturland wurde die Kirche im romanischen Stil auf den Grundmauern einer noch älteren Kirche, deren Überreste vor einigen Jahren im Rahmen von Renovierungsarbeiten entdeckt wurden, errichtet. Ursprünglich war nur ein Langhaus gebaut worden, das aber im XVI. Jahrhundert durch ein Querschiff ergänzt worden ist. Dieses Querschiff wurde von dem Seigneur de Cromières, Jean de Selve, gebaut, der damit als Wohltäter in die Geschichte dieser Kirche und dieses Ortes eingegangen ist. Er lebte in dem nahe von Cussac gelegenen Schloss Cromières, dessen Baugeschichte bis in das XI. Jahrhundert zurückreicht. Dieser Seigneur kam aus der Tiefe der französischen Provinz, wollte Gott auf seine Weise verherrlichen und holte sich aus diesem weltabgeschiedenen Winkel Frankreichs die Kraft, Weltpolitik zu betreiben. Er war der Kanzler von Franz I., der als Sohn Karls von Orléans, dem Grafen von Angoulême und der Louise von Savoyen am 01. Januar 1515 seinem Oheim, Ludwig XII., auf dem französischen Thron folgte. Als der Kaiser des Hl. Römischen Reiches Deutscher Nation Maximilian I. aus dem Hause Habsburg verstarb, bewarb sich Franz I. um den römisch-deutschen Thron – doch vergeblich. Die deutschen Kurfürsten wählten wiederum einen Habsburger auf den Thron, und dieser neue Kaiser, Karl V., konnte von sich behaupten, da auch Spanien seiner Krone unterstand und damit fast vollständig der südamerikanische Kontinent, dass in seinem Reich die Sonne nicht untergehe. Auch wenn Franz I. nicht deutsch-römischer Kaiser geworden ist, so kämpfte er aber 30 Jahre lang mit den Habsburgern um die Vorherrschaft in Europa – auch deshalb, um sich aus der Umklammerung der Staaten, die zum Reich gehörten, zu befreien. Gleich, nachdem es Franz I. nicht gelungen war, die begehrte Kaiserkrone zu erlangen, lieferte er sich mit Karl V. einen Kampf, um in Italien die Macht der Habsburger zu brechen. Da der französische König aber keine Verbündeten aufweisen konnte, nahm der erste Krieg zwischen diesen beiden Herrschern einen für ihn unglücklichen Ausgang. Nach einer Serie von Niederlagen führte Franz I. selbst seine Truppen in Italien gegen die kaiserlichen, doch der französische König wurde bei Pavia am 24.02.1525 besiegt. Er wurde gefangengenommen, um dann nach Madrid gebracht zu werden. Und nun tritt Jean de Selve auf die politische Weltbühne, und über diesen Auftritt spricht man noch immer im südlichen Limousin. Dem Kanzler des Königs, Jean de Selve, oblag es, mit Kaiser Karl V. einen Vertrag zu vereinbaren, auf Grund dessen Franz wieder aus der spanischen Gefangenschaft entlassen werden sollte. Er vereinbarte mit Karl V. den Madrider Frieden, der am 14. Januar 1526 feierlich besiegelt worden ist. Die Bedingungen waren hart. Doch Franz akzeptierte sie, da er von vornherein entschlossen war, sich nicht an sie zu halten. Mit einem Eid bekräftigte er diesen Madrider Friedensvertrag und verpflichtete sich, das Herzogtum Burgund an Karl abzutreten, auf Mailand und Neapel zu verzichten und darüber hinaus des Kaisers Schwester Eleonore, die Witwe des Königs von Portugal, zu heiraten. Als Bürgen für die Ausführung dieses Friedensvertrages musste Franz seine beiden Söhne als Geiseln stellen. Und doch: Kaum war Franz am 19. März 1526 freigelassen worden, sagte er sich von seinem Schwur los, obwohl seine beiden Söhne in Madrid gefangen gehalten wurden. Er berief sich auf den Widerstand der französischen Stände, die nicht bereit gewesen sein sollen, den Vertrag zu akzeptieren. Papst Clemens VII., der auf die Macht Karls V. eifersüchtig war, entband höchstselbst Franz von seinem Schwur und unterstützte dann den französischen König in seinen weiteren Auseinandersetzungen mit Karl V. So wie Jean de Selve die Kirche im XVI. Jahrhundert hat erweitern lassen, so bietet sie sich noch heute unseren Blicken dar. Das Querhaus ist genau so lang, wie das alte Langhaus, und so stellt sich uns dieses Gotteshaus als ein griechisches Kreuz dar, dessen Mittelpunkt, der Schnittpunkt der Achsen, dem Altar vorbehalten ist. Da auch das Querschiff im Stil der Romanik errichtet worden ist, findet der Betrachter einen stilistisch einheitlichen Raum vor, der nicht zwischen Alt und Neu trennt, sondern die Kirche als Harmonie der Linien erscheinen lässt, ohne Brüche, ohne gewollte Verschmelzung der so gegensätzlichen Stile der Zeiten. Als wir die Kirche betraten, umfing uns das Zwielicht eines geweihten Raumes, das die Distanz zu Gott geringer werden lässt. Herrschte draußen noch die Hitze des Sommertages, umfing uns in der Kirche eine angenehme Kühle. Nur gedämpft drangen die Sonnenstrahlen durch das bunte Glas des über der Westseite hoch oben eingelassenen kleinen Fensters und warfen Lichtbündel auf die Kirchenbänke und den Altar. Es war gebrochenes Licht, changierend in den Farben des Regenbogens, das uns in die Zeit zurückversetzte, in der die Kirchen noch nicht mit elektrischem Licht künstlich erhellt worden waren. Auf der Ostseite des Langhauses drei schmale und hohe Fenster, wie große Schießscharten, ausgefüllt auch sie mit buntem Glase, filigrane Ornamente darstellend, die, da die blaue Farbe vorherrschte, nur einen schwachen Schimmer in das Gebäude hineinließen und so das Geheimnisvolle einer Kirche, das Mystische der Liturgie noch deutlicher erscheinen lassen. Im nördlichen Querschiff ein großes Bild – ungewöhnlich für die Kirchen dieser Region, die spätestens in der Revolution fast jeglichen Schmuckes beraubt worden sind. Nur mit Mühe konnten wir das Sujet dieses Bildes erkennen, beinahe nur schemenhaft trat es aus dem Dämmerlicht und offenbarte uns die frühe Geschichte der Christianisierung Frankreichs. Die Heilige Valery wird auf diesem Bilde dargestellt. Sie gab ihr Leben für Christus und ist damit zu einer frühen Märtyrerin geworden. Nachdem sie, die als Römerin groß geworden war, sich zum Christentum bekehrt hatte, wollte sie auch ihren Mann bekehren. Doch dieser hing der alten Religion an, war wütend über Valerys Abkehr von seinem Glauben und ihrer Hinwendung zu Christus, und er strafte sie ob dieser Konversion durch Enthauptung. Das Bild zeigt uns die Szene, wie Valery ihren eigenen Kopf in Händen vor sich hertragend dem Heiligen Martial entgegentritt, der das Gebiet um Limoges zum Christentum bekehrt hat. Der Heilige dreht sich um, sieht die enthauptete Valery, sieht das in ihren Händen gehaltene Haupt, und in sein Gesicht ist ein Entsetzen geschrieben, das nur einen Menschen befallen kann, der sich zu Tode erschrocken hat. – Noch nicht lange hängt dieses Anfang des XVIII. Jahrhunderts gemalte Bild in dieser Kirche, erst seit einem Vierteljahrhundert. Und aufgehängt hat es der Bürgermeister von Cussac, der es in Limoges fand. Ursprünglich hing dieses Bild in einem Krankenhaus, wie uns mitgeteilt wurde. Es wurde als Leihgabe für eine Ausstellung gegeben, und während dieser Zeit wurde das Krankenhaus renoviert. Als die Ausstellung beendet war, war kein Platz mehr für dieses große Bild im Krankenhaus. Es wurde ein neuer Platz gesucht. Dies erfuhr der Bürgermeister von Cussac, verwies darauf, dass in seiner Kirche genügend Platz vorhanden sei, und so wurde ihm das Bild als Leihgabe überantwortet. Nun hängt es dort, als wenn es schon immer dort gehangen hätte und gibt Zeugnis von einer Zeit, als die Menschen noch so gläubig waren, dass sie lieber ihr Leben hingaben, als Gott zu verraten. Und noch auf eine weitere Besonderheit wies uns der Nachfolger von Jean de Selve, General Marquis de Bermondet de Cromières, hin – auf ein Bildnis, das in ein Kapitell eingemeißelt wurde. Es ist das Porträt eines unbekannten Mannes, der seine Hände hinter die Ohren hält, um besser hören zu können. Die Akustik soll in diesem Seitenschiff sehr schlecht gewesen, die Predigt soll kaum zu verstehen gewesen sein, und mit dieser Karikatur wollte der Bildhauer auf diesen Mangel aufmerksam machen – einem Mangel, der durch die moderne Technik einer Lautsprecheranlage inzwischen beseitigt werden konnte. Im gegenüberliegenden Querschiff findet der Betrachter einen Wappenstein, der an der Wand angebracht ist. Keine Worte, keine Zahlen, kein Hinweis auf den Träger des Wappens. Ein einfach strukturiertes Wappen, nur wellenförmige Linien, kein sprechendes, das seinen Ursprung im frühen Mittelalter erkennen lässt. Es ist das Wappen von Jean de Selve, der nur durch diesen Stein sein Mäzenatentum verschlüsselt und nur dem Eingeweihten ersichtlich andeuten wollte. Als im Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossen wurde, dass der Priester sich bei der Zelebrierung der Messe den Gläubigen zuzuwenden habe, war es auch in Cussac notwendig, einen Volksaltar zu errichten, von dem aus der Priester dieser neuen liturgischen Regelung des versus populum entsprechen konnte. Wiederum ergriff der Bürgermeister von Cussac die Initiative und ließ einen Altar aus den Steinen der Gegend errichten, exakt im Mittelpunkt der Kirche und ließ auf ihm die Worte einmeißeln "Spes Mea Deus", also "Meine Hoffnung ist Gott". Und unter diesem Wahlspruch wurde ein Wappen eingraviert, das an das von Jean de Selve erinnert. Im oberen Teil dieses quer geteilten Wappens erkennen wir zwei Tauben, im unteren die wellenförmigen Linien, und gleichsam als Helmzier Bäume. Lange rätselten wir, welche Familie dieses Wappen wohl führen würde, doch dann wurde uns gesagt, dass dieses auch vom Bürgermeister kreiert worden sei und dass es die Zeichen des Limousin darstellen: Den Maronenbaum und die Wellen, die das Wasser symbolisieren, all das, was dieser arme Landstrich im Übermaße besitzt und dazwischen – immer im Mittelpunkt – der Heilige Geist, verkörpert durch die Tauben. Hinter dem Altar, hart an der gesamten östlichen Mauer, sahen wir Ausschachtungen, über zwei Meter tief, und sie führen in die frühe Geschichte dieses Gebäudes. Stein um Stein wurde aus dem Fundament der Kirche gehoben, bis man auf den frühen Vorgängerbau stieß. Und hierbei grub man auch Gräber aus. Die sterblichen Überreste der unbekannten Verstorbenen wurden zwar diesen Grabstätten entnommen, doch sie wurden in Limoges ein weiteres Mal beigesetzt. Noch weiß man nicht allzu viel über die ursprüngliche Kirche, aber vielleicht gräbt man weiter, bis auch dieses Rätsel gelöst werden kann. Groß und bedeutend muss diese Vorgängerkirche nicht gewesen sein, eher eine kleine Kapelle, von der wir dann später in einer Beschreibung lasen, dass es eine église primitive gewesen sei. Nachdenklich verließen wir diesen heiligen Ort, den der neue Eigentümer nicht vergessen hat und der uns deshalb zeigte, wie auch der Staat mit dem ihm übertragenen Kirchenvermögen umgehen kann. Und diese Verbindung von Staat und Kirche wurde den Gläubigen in besonderer Weise vor Augen geführt, als die Kirchengemeinde den Abschluss der umfangreichen Renovierungsarbeiten mit einem Gottesdienst feierte. Der Bischof von Limoges, ein stattlicher Gottesmann, der seine beiden Konzelebranten, den Dorfpfarrer und den intellektuellen, über 80 Jahre alten, aus unserer Gemeinde stammenden emeritierten Professor des Institute Catholique de Paris um fast zwei Haupteslängen überragte – dieser Bischof begrüßte zuerst den Bürgermeister, danach den Unterpräfekten, schließlich den Deputierten der Nationalversammlung sowie die verschiedenen anderen Abgeordneten und erst dann die Gläubigen. Er dankte den Vertretern des Staates für ihr Engagement und für den großen finanziellen Aufwand, der erbracht werden musste, um die Renovierung der Kirche vornehmen zu können. Dabei erwähnte der Bischof lobend die gute Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat, ohne allerdings zu verschweigen, dass es ein langer Weg gewesen sei, von der durch die „Laiengesetze“ erzwungenen totalen Trennung von Kirche und Staat hin zu dieser Zusammenarbeit. Als wir aus der Kirche hinausgingen und uns das warme Licht der untergehenden Sonne ein wenig blendete, verweilten wir noch im Schatten eines Vordaches, das wie eine Laube dem Eingang vorgelagert ist. Die großen Feldsteine des Bodens sind von den Schuhen der Gläubigen, die sich hier nach dem Gottesdienst noch trafen, um ein wenig die Predigt zu besprechen, zu plaudern, zu lachen, zu scherzen und so zur Gemeinde zu werden, glattgeschliffen. Unzählige Male versammelten sich hier die Gläubigen, seit vielen Jahrhunderten trafen sie sich unter diesem Dach, auch deshalb, um die durch die Messe erzwungene Ruhepause in ihrer Arbeit noch um ein paar Worte zu verlängern. Immer dann, wenn es sich jetzt der Priester des Pfarrbezirkes, der über 50 km im Durchmesser misst, einrichten kann – und das ist nicht oft –, treffen sich hier nach dem Gottesdienst die Gläubigen, sei es aus fröhlichem Anlass, sei es aus traurigem, unter diesem alten Dach ist dann die Gemeinde vereint. Ein wenig ermattet genossen wir den Schatten, betrachteten die Tür, die ins Querschiff führt und die Jean de Selve mit einem Rahmen im Flamboyant-Stil hat verzieren lassen, und plötzlich war es uns, als ob wieder die verwehten Töne von Schuberts "Ave Maria" erklangen und mit der Melodie die Erinnerungen erwachten. Vor wenigen Jahren war es, dass dieser Vorplatz dicht gedrängt von Menschen war. Die Braut in einem weißen Kleid mit langem Schleier, der Bräutigam im morning coat, viele Hüte, mit denen sich die Damen gegenseitig übertrafen, viele goldene Sterne auf den khakifarbenen und blauen Uniformen, geschmückt mit den hohen und höchsten Orden eines Staates, der ein ungebrochenes Verhältnis zu seiner kämpferischen Vergangenheit hat, dann Kleider, wie sie nur in Paris geschaffen werden können, und über allem der Duft der verschiedenen Parfums und der Blumen. Die Eleganz des ancien regime war hier noch einmal zu sehen, die Ungezwungenheit und auch die Leichtigkeit, die nur die Tradition zu vermitteln vermag und eine Selbstverständlichkeit schafft, die das Leben so einfach macht. Für einige wenige Momente war diese Kirche und der Vorplatz mit Leben erfüllt, prall und pulsierend, und in diesen Augenblicken war die Kirche wieder das, was sie jahrhundertelang gewesen ist: Mittelpunkt im Sein der Gläubigen. Doch als der letzte Gast diesen Ort verließ, um im Schatten anderer uralter Mauern in Cromières, dem alten Schloss von Jean de Selve, dem Brautpaar zu gratulieren, da sank diese Kirche wieder zurück in ihre Ruhe und Abgeschiedenheit. Unregelmäßig und in großen Abständen trifft sich hier die verstreute Gemeinde, fest entschlossen, zusammen mit den Vertretern des Staates diese Kirche auch den nächsten Generationen zu übertragen. Sie wissen um ihren Schatz, auch wenn er nicht von vielen gesucht wird, sie hüten dieses Kleinod und führen zusammen mit der politischen Gemeinde das fort, was ihre Vorgänger auch immer gemacht haben, sie stehen gleichsam in einer Sukzession, und das ist es, was der Kirche das Überleben ermöglicht – auch jenseits der Touristenzentren und der weltberühmten religiösen Stätten. Als wir nach der Messe wieder zurückfuhren, lag links neben uns in Cromières das Haus, in dem Jean de Selve einst wohnte. Im XI. Jahrhundert wurde der erste Donjon gebaut, vor nunmehr eintausend Jahren. Dieser Herrschaft oblag es, die niedrige, aber auch die hohe Gerichtsbarkeit auszuüben, und um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wurde schon früh neben dem Chateau ein Gerichtssaal errichtet, nicht im romanischen Stile, sondern im gotischen. Doch als die Reformation auch diesen fernen Winkel Frankreichs erreichte, nahm ein Teil der dort lebenden Familie den neuen Glauben an. Eine katholische Kapelle gab es schon im Chateau, und eine evangelische sollte geschaffen werden. Der Gerichtssaal wurde in einen temple umgebaut, in einen Tempel, wie in Frankreich die evangelischen Kirchen genannt werden, und so wurden am Sonntag zwei Gottesdienste gefeiert: Ein katholischer und ein evangelischer. Auch wenn draußen der Krieg um die wahre Religion wütete und viele Menschen auf beiden Seiten immer im Namen Gottes zu Opfern wurden – in Cromières herrschte eine Toleranz und die hieraus erwachsene Eintracht. Katholiken und Protestanten existierten nebeneinander, sie hielten Frieden, vielleicht auch deshalb, weil sie wussten, dass das Christentum auch nur aufgrund einer Reformation geschaffen wurde. Und diese Toleranz sollte Cromières zum Vorteil gereichen. Der Anführer der Hugenotten, Admiral de Coligny, der so viel Unglück über das Land brachte, machte vor Cromières Halt. Als er von der Toleranz des Besitzers, des Marquis de Cromières, hörte, als er erfuhr, dass auch die Glaubensbrüder des protestantischen Feldherrn ihre neue Religion ungestört und ohne Einschränkungen nachgehen können, da verschonte er diesen Ort, ließ ihn unbeschädigt zurück und zog weiter, um mit dem Schwert, so wie in den Kreuzzügen, den Menschen im Namen Gottes die neue Religion aufzuzwingen. Später wurde der temple nicht mehr gebraucht, nur noch die katholische Kapelle, und da mit dem Ende der Feudalzeit und des Absolutismus auch Cromières seine Gerichtsbarkeit verlor, konnte dieses Gebäude nicht mehr den ursprünglichen Zwecken zugeführt werden. Da aber in einer Landwirtschaft mit Vieh immer wieder neue Ställe gebraucht werden, so wurde dieses Gebäude zum Stall umfunktioniert – ganz profan, ganz praktisch. Nur noch die gotische Einrahmung der Tür erinnert an vergangene große Tage, in denen über das Schicksal anderer, in denen aber auch über das eigene Schicksal entschieden wurde. Lothar Rilinger (siehe Link) ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht i.R., stellvertretendes Mitglied des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes a.D., und Autor mehrerer Bücher. kath.net-Buchtipp: Foto: St. Pierre in Cussac © Lothar C. Rilinger/Mit freundlicher Erlaubnis Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuFrankreich
| 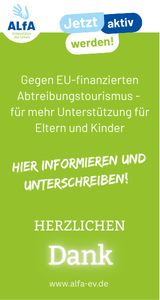       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
