 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Kongress zum Turiner Grabtuch in Wienvor Minuten in Aktuelles, keine Lesermeinung Neueste Ergebnisse zum "wissenschaftlich am meisten untersuchten Einzelobjekt der Forschung" werden erwartet. Wien (www.kath.net/PEW) Vom 28. bis 30. Mai findet im Wiener Erzbischöflichen Palais ein internationaler Kongress über das Turiner Grabtuch statt. Das Grabtuch zeigt die Abdrücke eines gefolterten und gekreuzigten Menschen. In der wissenschaftlichen Forschung ist umstritten, ob es sich dabei um den Körperabdruck des gekreuzigten Jesus oder um ein mittelalterliches Kunstwerk handelt. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Giuseppe Ghiberti, Mitglied der Päpstlichen Bibelkommission, werden renommierte Experten aus aller Welt über die neuesten Forschungsergebnisse aus theologischer, historischer, medizinischer und naturwissenschaftlicher Perspektive berichten. Zu den Referenten zählen unter anderem Prof. Gian Maria Zaccone, Direktor des "Museo della Sindone" in Turin sowie Prof. Karlheinz Dietz, Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität Würzburg. Der Kongress wird von der Wiener Katholischen Akademie veranstaltet, Protektor ist Kardinal Christoph Schönborn, der auch selbst als Vortragender an der Tagung teilnehmen wird. Wie Elisabeth Maier, Leiterin der Katholischen Akademie und Initiatorin des Kongresses, betont, habe das Turiner Grabtuch nicht nur Jahrhunderte von Frömmigkeitsgeschichte und ikonographischer Tradition mitgeprägt, "es übt auch auf unser wissenschaftsorientiertes Zeitalter eine nicht geringer werdende Faszination aus". Das Grabtuch sei das wissenschaftlich am meisten untersuchte Einzelobjekt der Forschung, so Maier. Das auf italienisch "la Santa Sindone" genannte Grabtuch zeigt die Abdrücke eines gefolterten Menschen. Der vordere Abdruck zeigt den Kopf und das Gesicht eines Mannes von 1,70 bis 1,80 Metern Größe, mit langen Haaren, Schnurr- und geteiltem Backenbart. In den Haaren und im Gesicht sind Blutspuren sichtbar, die Gesichtszüge lassen auf zahlreiche Verletzungen wie Schwellungen unter dem Auge und am Unterkiefer schließen. Auf der rechten Seite des Oberkörpers sieht man eine Schnittwunde, die einen großen Blutfleck hinterließ. Weiters weist der Körper zahlreiche Verletzungen auf, die von Geißelungen her rühren. Historisch gesichert ist, dass das heute in Turin verehrte Tuch im 14. Jahrhundert in Frankreich auftauchte. Um 1350 schenkte der französische Adelige Geoffroy de Charny der Kirche in Lirey ein Leinentuch, auf dem sich ein Abbild befand, das als Abdruck des gekreuzigten Christus angesehen wurde. Den Weg nach Lirey soll das Tuch - der Tradition nach - über Edessa (heute: Urfa in Ostanatolien) und Konstantinopel gefunden haben. Der Kreuzritter Robert Clary berichtete, er habe im Jahr 1203 in einer Kirche Konstantinopels ein Grabtuch gesehen, welches das Abbild des ganzen Körpers Jesu zeige. Bei der Plünderung Konstantinopels 1204 durch die Kreuzritter verschwand das Tuch, um erst Mitte des 14. Jahrhunderts in Lirey wieder aufzutauchen. Gut hundert Jahre später übersiedelte das Tuch nach Chambery, wo es 1532 den Brand der dortigen Kapelle relativ heil überstand. 1578 gelangte das Grabtuch schließlich nach Turin, wo es vorerst im Dom aufbewahrt wurde, bevor es 1696 in die prächtige Kapelle von Guarino Guarini, zwischen Dom und Hofburg, übersiedelte. Auch ein Brand in der Kapelle 1997 konnte dem Tuch nichts anhaben. 1988 hatten Forscher das Tuch in einem sensationellen C-14-Test auf das Mittelalter datiert. Ein Stück Gewebe vom Rand des Grabtuchs war nach der Radiokarbon-Methode analysiert worden, drei unterschiedliche Labors hatten dabei unabhängig voneinander die Probe auf den Zeitraum zwischen 1260 und 1390 datiert. Zweifelhaft blieb jedoch, ob die Probe durch spätere Zusätze zum Grabtuch, etwa Pilze, Mikroben oder Brandspuren, verunreinigt war.Vor vier Jahren stellte die Historikerin Marlen Eordegian fest, sie habe in Israel und in Armenien mehrere Manuskripte eingesehen, die für die Existenz des Grabtuchs Christi in Edessa lange vor der Jahrtausendwende sprechen. Zum gleichen Schluss kam auch die Grabtuch-Forscherin Maria Grazia Siliato, der zufolge das Grabtuch mit dem im ganzen Nahen Osten während des ersten Jahrtausends hochverehrten "Ikon Acheiropoietos" (des "nicht von Menschenhand geschaffenen Bildes Christi") von Edessa identisch sei. 944 war dieses Tuch nach Konstantinopel gebracht worden. Wenn es Historikern tatsächlich gelingen würde, die Identität des in den Manuskripten bezeugten Grabtuches von Edessa mit dem von Turin nachzuweisen, wären zumindest die Thesen über eine Herstellung des Grabtuches als Fälschung des Spätmittelalters in Frankreich endgültig widerlegt. Schon 1996 hatten Forscher aus Turin berichtet, sie hätten auf dem Leichentuch den Abdruck einer römischen Münze gefunden, deren Prägung auf das 16. Jahr der Herrschaft des römischen Kaisers Tiberius hinweist (Jahr 29 christlicher Zeitrechnung). Auch dies sei ein Indiz dafür, dass das Leinentuch bereits an die 2000 Jahre alt sei. 1999 berichtete die israelische Tageszeitung "Haaretz", dass Forscher der jüdischen Universität von Jerusalem auf dem Tuch Pollen und andere organische Stoffe fanden, die für die Region Judäa typisch seien. Insbesondere seien Spuren der sogenannten "Akuvit Hagalgal"-Pflanze ("Gundelia") entdeckt worden, die nur auf den Hügeln um die Heilige Stadt zu finden sei. Auch andere Mikrobiologen vertreten die These, die Reliquie stamme nach jüngsten Forschungen "fast sicher" aus der Zeit Jesu. Sie betonen allerdings auch, dass sich mit ihren Ergebnissen nicht beweisen lasse, dass es sich tatsächlich um das Leichentuch Jesu handle. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuGrabtuch
|       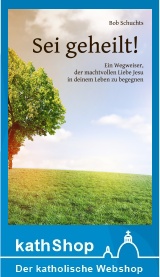 Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
