 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||||||||||
              
| ||||||||||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  In Memoriam Heinrich Pfeiffer 28.November 20214. Dezember 2021 in Aktuelles, 1 Lesermeinung Regen von Rosen auf dem Berg der Verklärung. Aus dem Jahr 2004 in dem Buch „Das Muschelseidentuch von Paul Badde Linz (kath.net) Ich kannte das Tuch nun seit Jahren und seitdem auch fast alle Argumente dafür und dawider. Ich hatte Bücher gewälzt,Kataloge geblättert, stapelweise Bolletini und unzählige Fußnoten studiert. Die Argumente für und gegen die Echtheit des Antlitz-Bildes wiederholen sich. Fast kaum ein Besucher, der sich nicht erst einmal an der »Hässlichkeit« des Gesichtes stört, Ellen, meine allerbeste Frau, und meinen Freund Peter eingeschlossen (»grässlich«) – oder auch mein Freund Christian (»grauenhaft«). Und fast alle sind sich zuerst einmal in einem einig: »So nicht!« Ich konnte sie irgendwie alle verstehen. Flüchtige wie aufmerksame Besucher können die tausend Gesichter in diesem Bild zuerst kaum sehen: die unendliche Zahl. Eher sehen dies die Hand voll Frauen, die die Kirche putzen oder jeden Morgen zur Messe in die Kirche kommen. Eher sehen es also Rita aus der zweiten, Teresa aus der dritten oder Pia und Silvia aus der vierten Bank – oder Oswaldo, der bärtige Messner mit seiner rauen Stimme, der bei keinem Gottesdienst fehlt. Und am allerbesten sieht es natürlich ohnehin Schwester Blandina. Kein Mensch in der Geschichte – von der Madonna einmal abgesehen – hat wohl so viele Stunden davor verbracht wie sie in den letzten paar Jahren. »Nein!«, sagt jedoch Pater Lino im Konvent, »ich persönlich – und das können Sie ruhig schreiben – habe gesehen, wie Padre Domenico jeden Morgen um vier Uhr – um vier Uhr! – schon im Gebet vor dem Volto Santo kniete. Er hat mehr Zeit als jeder andere davor verbracht!« »Stellen Sie sich einmal hierhin«, sagt Blandina einmal wieder zu mir, »hier ist er so besonders schön.« Ich stelle mich an ihre Stelle und sehe ein vollkommen anderes Bild. Weil ich einen Kopf größer bin, sehe ich durch das Bild die Neonleuchte an der Säule dahinter, von der Blandina an der gleichen Stelle gar nichts sieht. Zehn Leute vor dem Tuch sehen alle etwas anderes – alle durch ihren verschiedenen Winkel. Deshalb versperren Fotos auch eher den Weg, als dass sie ihn hierhin ebnen. Es gibt in der Stirn, den Schläfen und unter dem rechten Auge ein inneres helles Blutrot in den Fasern, das fast nur sichtbar wird, wenn es keine direkte Beleuchtung gibt – oder das erst am Computer wieder hervorgeholt werden kann. Dieses Gesicht verlangt nach Ikonen. Es verlangt nach Übersetzungen. Jedes Foto von jedem alten Meister ist wirklichkeitsgetreuer als von diesem changierenden Lichtbild. Es lässt sich nicht vervielfältigen, ebenso wie sich Personen – bisher noch – nicht klonen lassen. Eines Abends im Dezember drängt mir Schwester Blandina eine schwere Taschenlampe auf, als ich im Dunkel von ihrer Einsiedelei zum Konvent der Kapuziner hinuntergehen will. »Nein«, sage ich, »brauch ich nicht.« »Doch«, sagt sie, »man kann da draußen seine Füße nicht sehen.« »Nein«, sage ich, »ich nehme die Sterne« – und nehme ihre Lampe mit. Am nächsten Morgen bringe ich sie ihr vor dem Heiligen Antlitz zurück, wo wir uns verabredet haben. Ich habe wieder zwei Stühle nach oben geholt; wir schauen uns das Bild an, die Kirche ist wieder menschenleer, Blandina hat die Beleuchtung ausgeschaltet. Draußen regnet es. Da schalte ich die Taschenlampe an und richte den schmalen Lichtkegel auf die Stirn, wandere zu den Augen hinunter, zum Mund. Der Wechsel von statischem zu bewegtem Licht ist verblüffend. Das Bild ändert nicht seine Natur, aber seinen Ausdruck, es ändert völlig das Empfinden des Betrachters. »Oh!«, ruft Blandina, »oh, oh!« Das hat sie noch nie gesehen, die das Bild doch jetzt schon so lange kennt. Ich reiche ihr die Lampe hin, dann tastet sie das Gesicht mit dem Lichtkegel ab wie Maria Magdalena das Gesicht Jesu abgetastet haben mag, im Leben mit ihren Blicken, bei seinem Tod mit ihren Fingerspitzen. In dem tastenden Licht ist dieser Blick, als gehöre er jemandem, der gerade durch die Mauern in dieses Zimmer getreten ist. So muss er Thomas angeschaut haben. Und so ähnlich kommt er den Menschen hier zweimal pro Jahr entgegen – wenn das Bild sich jedem, der es anschauen kommt, selber mitteilt: wenn es aus der Kirche in einer Prozession ins Freie tritt. Die längere dieser Prozessionen findet am dritten Sonntag im Mai statt, die kürzere am 6. August, dem Festtag der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor. Beide Male ist es eine Aussetzung des Lichtbildes an natürliches Licht, einmal am hellen Tag, das andere Mal vor der Dämmerung: ein Akt unglaublicher Verlebendigung. Schon am Abend vor der Maiprozession ist Manoppello nicht wiederzuerkennen. Bus an Bus reiht sich dann unterhalb der Kirche auf einem sonst das ganze Jahr über verwaisten Parkplatz. Vom Norden und vom Süden sind die Menschen ins Dorf geströmt. Am Abend zuvor übt Manoppello. Dann wird eine Holzfigur des heiligen Pankratius aus der Kirche von der Piazza Garibaldi im gegenüberliegenden Städtchen im sinkenden Abendlicht zum Heiligtum herübergetragen, wo sie am nächsten Tag das Christusbild »abholen« kommt. Alle Frauen sind, wenn man von hinten in die Kirche hineinschaut, gerade frisch beim Friseur gewesen. Eine Glaskapelle aus Tarent begleitet den Zug. Solange sich die Prozession mit Pankratius noch durch die engen Gassen der Stadt drängt, wird sie aus den oberen Fenstern von Rosenblättern beregnet, die Frauen hinunterwerfen, sobald sie das Städtchen verlässt, um hinüber auf den Tarigni- Hügel zu pilgern. Dort wird Pankratius von allen Hügeln mit einem Böllergewitter begrüßt und einem Feuerwerk vor dem Spätnachmittagshimmel. Doch das ist, wie gesagt, nur die Generalprobe. Das Pilgerhotel Il Volto Santo neben der Kirche platzt aus allen Nähten. Auf dem Parkplatz davor sind Bratküchen und Buden für Süßigkeiten aufgebaut und dringend notwendig. Wer sollte die Pilger sonst beköstigen können? Manoppello ist voll mit alten Ehepaaren, Bauern und Bäuerinnen, die in der Bar des »Heiligen Gesichts« schon frühmorgens eingelegte gelbe Bohnen und Schweinespießbraten essen und Bier dazu trinken. Aus Amerika, Deutschland und Italien sind diesmal drei leibliche Schwestern Blandinas angereist. Nebenan in der Kirche wird seit der Früh eine Messe nach der anderen gelesen, alle bis auf den letzten Platz besetzt. Besonders die Frauen singen noch lauter als sonst, mit enormem Druck in den Stimmen. Vor dem Altarraum steht ein schweres Tragegestell, mit silbern bemaltem Holzaufbau. Der 87-jährige Pater Ignazio hat schon nach der ersten Messe in goldenen Brokatgewändern den Pater Guardian zu der riesigen Monstranz begleitet und eine feierliche kleine Prozession von dem Schrein über dem Hauptaltar durch das Seitenschiff und den Mittelgang hierhin geleitet, wo das Heilige Gesicht nun für die Reise auf diesem Gestell befestigt wird. Frauen und Männer drängen sich nach vorn, um dem Bild Kusshände zuzuwerfen, das Glas zu berühren oder Blumensträuße vor ihr Heiligtum zu legen. Das Hauptportal der Kirche ist weit offen. Während der Messen räkelt sich ungestört ein herrenloser Hund im Mittelgang vor dem Altar, wälzt und juckt sich gemütlich und betreibt mit der Schnauze Körperhygiene. »Der ist immer hier«, habe ich in der Bar gehört. »Manche halten ihn für einen reinkarnierten Kapuziner, der noch einiges gutzumachen hat.« Raue Stimmen versammeln sich zum Credo an den »Schöpfer des Himmels und der Erde und aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge«. Dann wird das Heilige Antlitz auf der Tragbahre von vier Männern einer Bruderschaft in roten Gewändern vor das Hauptportal getragen und noch einmal abgesetzt, wo es vom Kircheninneren her schneeweiß durchsichtig gegen den Himmel leuchtet. Der ehrenwerte Bürgermeister wartet draußen mit seiner Trikoloren-Schärpe im Kreis anderer Honoratioren, neben sich den Bürgermeister aus Pescara und andere Gemeindeoberhäupter der Umgebung. Die Blaskapelle ist wieder da, Menschen von der Küste und aus dem Gebirge, der Platz vor der Kirche ist schwarz vor Menschen. Schließlich setzt sich eine Gruppe mit der schwankenden Pankratius-Statue als Anfang des Zuges in Bewegung. Eine Kindergruppe in weißen Kleidern und angenähten Engelflügeln führt die Gruppe der Kapuziner in ihren braunen Kutten an, die mit Gesängen und rauchenden und schwingenden Weihrauchfässern dem Heiligen Gesicht den Weg bereiten, hinter ihnen zwei Carabinieri in ihren Paradeuniformen, mit roten Federbüschen auf ihrem Dreispitz. Dann wird das Volto Santo aus der Kirche getragen. Ich warte an der linken Säule des Portals. Sobald das Heilige Gesicht die Kirche verlässt, wechselt es in ein helles Silbergrau gegen den Himmel. Und von nun an wechselt es mit jedem Schritt sein Aussehen, in jeder Kurve. Auf diesem Weg verändert das Bild an jeder Ecke und jeder Biegung des Weges und aus jedem Winkel sein Aussehen – bei strikt gleichbleibender Identität. »Wie freundlich er doch schaut!«, sagt Ellen an der ersten Kurve, »er hat gelacht, als er aus der Kirche herausgetragen wurde. Hast du das gesehen? Als hätte er das ganze Jahr darauf gewartet.« – »Er ist nicht immer freundlich«, sagt da der alte Signor Blasioli neben uns, der im Krieg erlebt hat, wie ganz Manoppello mit Nebel bedeckt war, als die Alliierten es beim Rückzug der Deutschen angreifen wollten. Er könne mir noch die Stellen zeigen, hat er mir gesagt, wo sie durch diesen Nebel hindurch vier Bomben abgeworfen hätten die weder einem Menschen ein Haar gekrümmt hätten, noch einem Tier ein Haar oder eine Feder oder auch nur ein einziges Haus angekratzt hätten. Das Heilige Gesicht habe Manoppello vor jedem Schaden bewahrt. »Doch nein, er ist nicht immer freundlich«, sagt der alte Luigi noch einmal, »er ändert sich immer, und manchmal ist er auch streng.« Die Akazien stehen in voller Blüte und duften betörend links und rechts der Serpentinen des Weges der Prozession, die sich sehr langsam, in vier Windungen den Tarignihügel hinunterzieht, bis zur Hauptstraße, die wieder in die Stadt hochführt. Vor dem Grün des Hügels wird das Gesicht fast fleischfarben, mit grünen Augen, über der nächsten Brücke wird es wieder silbern vor dem Himmel, zwischendurch verschwindet es – und schaut hier jeden und jede doch fortwährend an. Ganz zart und ganz stark. Im seitlichen Schatten schaut er manchmal wie einer, der hinter einem Vorhang aus dem Fenster herausschaut. Zwei Schritte weiter sieht es so aus, als schiebe er selbst den Vorhang zur Seite. In dem Städtchen haben die Frauen an jedem Haus, an dem es vorbeizieht, ihre schönsten und kostbarsten Tücher und Brokate und Damast aus den Fenstern gehängt, von wo sie das Bild, wie von jedem Balkon, mit Händen voller Rosenblätter überrieseln, als wären es Feuerzungen, die auf die Pilger herabregneten. Das Feuerwerk ist wieder da, am Morgenhimmel, danach wieder die allerfeinsten Weisen der Blaskapelle. Die Einführung der Prozession war ein genialer Einfall. Denn nur so – im natürlichen Licht – gibt das Bild ja sein volles Aroma frei wie ein geöffneter Flakon sein Parfüm. Früher muss der Kontrast zum Rest des Jahres noch viel intensiver gewesen sein, als sich das »Heilige Antlitz« das ganze Jahr über verborgen in einer schattigen Seitenkapelle der Kapuzinerkirche befand. Bis zur Erfindung Thomas Edisons sah es – in diesem permanenten Dunkel und Dämmer – vermutlich wirklich so dunkel aus wie das Mandylion des Vatikans oder das aus Genua. Keine noch so raffinierte Beleuchtung aber kommt der Steigerung der Erfahrung nahe, die von diesem Gesicht ausgeht, wenn es unterwegs der Sonne im Morgen-, Tages- und Abendlicht ausgesetzt wird. Es ist das wahre Licht dieses Gesichts. Inzwischen sind wir durch das romanische Löwen-Portal in die San-Nicola-Kirche eingezogen. Pater Pfeiffer zelebriert als Ehrengast aus Rom die Festmesse, in der er vom Paradies predigt, selig, gerötet, immer lächelnd. In diesem Himmelsgarten ist er zwar noch kein Ehrenbürger, wohl aber – seit Jahren schon und immerhin – in Manoppello. Er lädt uns zum Abendessen in einen Landgasthof außerhalb des Städtchens ein, wo er natürlich auch Ehrenkonditionen genießt und die einfache Küche noch eine Ahnung davon vermittelt, dass früher einmal alle Köche der Päpste Abbruzzeser zu sein hatten. »Pater Pfeiffer«, sage ich schon auf dem Weg dahin, auf dem es sich an diesem Festtag gefahrlos mitten auf der Straße gehen lässt, »ich hatte noch ein paar Fragen vergessen. Wenn es wirklich wahr ist, dass in diesem kleinen Abruzzenstädtchen das einzige authentische und wahre Bild Christi auf der Erde verwahrt wird, wenn das so ist, sind dann nicht all Ihre Argumente Kinkerlitzchen, die nicht wirklich erklären können, warum das vierhundert Jahre einfach unbekannt geblieben sein soll? Wenn das wahr ist, hätte es sich doch längst wie ein Lauffeuer verbreiten müssen! Alles andere ist doch einfach unglaublich. Warum, frage ich Sie also noch einmal, warum soll Ihnen das irgendjemand glauben und nicht stattdessen Sie – oder jeden und jede andere, die Ähnliches behaupten – viel einfacher für verrückt halten? Warum?« »Warum, fragen Sie? Warum soll man dem christlichen Credo glauben, wie es eins Komma zwei Milliarden Katholiken und rund zwei Milliarden Christen insgesamt tun – oder zumindest tun sollten, wenn sie sich Christen nennen? Das muss man doch nicht: ›Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an seinen einzigen Sohn …‹ Das muss man doch nicht glauben und kann es doch auch kaum. Dass der ›Schöpfer des Himmels und der Erde‹ jemals Mensch geworden sein soll, wie Christen es für wahr halten, das scheint in sich doch einfach verrückt – und so haben die Juden diesen Glauben, der aus ihrer Mitte hervorgegangen war, doch auch von Anfang an gesehen. Und so sehen sie ihn ja auch heute noch, zusammen mit den Muslimen und Buddhisten und Hindus und Heiden und Agnostikern und Atheisten. Dass Gott für Katholiken seitdem nie mehr fern ist, sondern ganz und gar präsent sein soll in einem kleinen Stück geweihten Brotes, das in jeder römischen Kirche in einem goldenen Tresor über oder neben dem Hauptaltar verwahrt wird – der Schöpfer des Himmels und der Erde, eingeschlossen in die Materie und hinter einem Riegel! –, das scheint einfach vollkommen absurd. Es ist eine Herausforderung an Sinn und Verstand! Doch das ist der Glaube der römischen Kirche, auch wenn er de facto selbst von immer weniger Katholiken geteilt wird. Denn es bleibt ja einfach unglaublich. Ist es da, frage ich nun Sie, nicht eine viel geringere Herausforderung an Sinn und Verstand, dass Gott von dieser seiner Menschwerdung zweitens auch noch ein authentisches Bild hinterlassen haben soll und dass – drittens – dieses Bild, das früher nur der byzantinische Kaiser mit dem höchsten Klerus zu ganz besonderen Gelegenheiten in den kaiserlichen Gemächern von Konstantinopel für jeweils nur wenige Minuten im Kerzenschein sehen durften, dass dieses gleiche Bild heute für jedermann offen im Licht von Halogenstrahlern zu sehen ist, der es anschauen will? Dass es jederzeit, und so lang man will, hier in den Abruzzen zu besichtigen ist? Keiner muss irgendetwas glauben. Doch was ist denn da das größere und was ist das kleinere Wunder? Das ist das eine. Eine andere Sache, die mit Glauben oder Nichtglauben überhaupt nichts zu tun hat, ist die Tatsache, dass es sich bei dem ›Heiligen Gesicht‹ von Manoppello schlicht um eine technische Unmöglichkeit handelt, die jeder, der will, selbst und mit bloßem Auge überprüfen kann.« Jetzt kam ich wieder in Fahrt und fragte: »Nehmen wir nun aber einmal an – und sei es nur für einen Moment –, dass dieser oder der nächste Papst Ihren Argumenten folgen und nach Manoppello pilgern würde, wie Johannes Paul II. noch im Jahr 1998 nach Turin gepilgert ist. Nehmen wir weiter an, dass das Schleierbild danach für alle Forschungen und Untersuchungen freigegeben würde. Nehmen wir weiter an, dass Sie – entweder zu Ihren Lebzeiten oder danach – in allen oder den meisten Ihrer Theorien und Hypothesen bestätigt und gerechtfertigt würden. Was würde sich dadurch ändern, für die Kirche und für die Welt?« »Es würde ein gewaltiges Erdbeben geben. Es ist das letzte Maß des Menschen, das damit in die Kirche zurückkommen wird. Es ist das Inbild jeder Person und seiner Freiheit – ganz Mensch und doch ganz unserer Willkür entzogen. Vor diesem Blick werden sich viele Streitfragen und Irrlehren in nichts auflösen. Vor diesem Blick schmilzt jede Feindschaft um in Erbarmen. Denn die Kirche hat ein einziges Haupt, und das ist Christus. Er ist der Herr. Und hier ist ein wahres Bild von ihm. Älter als jeder Text! Wenn wir also auch materiell noch gemeinsam ein wahres Bild von ihm haben, ist die Wiedervereinigung der Christenheit viel leichter – mit den protestantischen Kirchen ebenso wie mit den orientalischen Kirchen und der Orthodoxie der Griechen und Russen, bei denen die Ikone von jeher einen unvergleichlich höheren Rang innehatte als im Westen. Im Osten hatte das Bild – auch ohne dieses Original und diese Bildmutter all ihrer Christusikonen – schon immer den gleichen Rang wie die Heilige Schrift; im Osten galt das Bild schon immer selbst als Schrift. Das wird mit dieser Entdeckung noch einmal eine ungeahnte Dimension bekommen. Für die Ökumene wird die volle Wiederentdeckung und Anerkennung und Annahme der Ur-Ikone des wahren Christusbildes also eine geradezu revolutionäre Bedeutung haben, mit enormen Folgen; daran ist überhaupt kein Zweifel möglich. Vielleicht liegt Manopello darum – an der Adriaküste – ja auch an der alten Schnittstelle und Bruchlinie zwischen der östlichen und westlichen Christenheit. Eine andere gravierende Auswirkung wird die Wiederentdeckung dieses Bildes jedoch auch für die Rolle des Papsttums spielen und spielen müssen.« »Wieso?« »Weil das, was die Menschen und Pilger früher nach Rom gezogen hat, die Veronika war: Das war das wahre Bild Christi. Den Päpsten fehlte also während der letzten 400 Jahre das wichtigste Stück, das die Leute angezogen hat: nämlich die Veronika. Ihretwegen sind sie gekommen. Den Papst wollten die Pilger eigentlich nicht sehen. Der war ein Potentat wie alle anderen. Und oft war er auch nicht gerade ein Vorzeigeexemplar; er war nicht besser als jeder andere Herrscher auch. Das hat sich heute Gott sei Dank sehr geändert – und das wird und muss auch so bleiben. Als Nachfolger des Petrus, also jenes Apostels, auf dessen schwachen Schultern die Kirche von Jesus selbst errichtet worden ist, wird die Bedeutung der Päpste noch wachsen. Ihre Rolle als Stellvertreter – als Vicarius Christi – aber, die wird sich nicht nur gewaltig ändern, sondern überhaupt wieder von ihren Schultern genommen werden. Denn diese Rolle war ursprünglich überhaupt nicht bei den Päpsten, und das Verständnis der Rolle des Stellvertreters stammt auch überhaupt nicht aus dem Westen, sondern dem Osten, aus dem byzantinischen Verständnis des oströmischen Kaisertums. Dort in Konstantinopel galt nämlich immer der Kaiser als der erste Vikarius Christi – seit den Tagen Kaiser Konstantins des Großen, seit dem Jahr 313. Und das war nur möglich, wenn er sich dabei auf ein Bild berufen konnte, das ihm irgendwie in den Schoß gefallen sein musste. Denn im Osten konnte immer nur ein Bild den Kaiser selbst vertreten, nie eine andere Person. Wenn der Kaiser selber nicht in die Provinzen kommen konnte, hat er sein Bild geschickt – und das Bild wurde an den Stadttoren mit Kerzen und Fackeln empfangen, als wäre es der Kaiser selber. Keine Person konnte ihn vertreten, immer nur sein eigenes Bild! Allein das Bild war immer Stellvertreter des Kaisers; das fing auf den Münzen an und ging bis zu den Bildern der Staatspräsidenten, die wir heute noch in den Amtsstuben hängen haben. Daher kommt das. Und so wie das Bild des Kaisers der Stellvertreter des Kaisers war, so kann auch nur das Bild Christi wahrer und unkorrumpierbarer Stellvertreter Christi sein. Dass wir nun das stellvertretende Bild Christi wieder vor uns haben, das wird nicht nur der Schlussstein für die Ökumene sein. Das wird auch ein Erdbeben geben in der Kirche. Ich habe Kollegen, die sagen mir: ›Wenn du Recht hättest, wäre es eine Revolution.‹ – Die können die Sache aus dem einfachen Grund nicht anerkennen und für wahr halten, weil sie ihnen zu groß erscheint. Das ist das Problem– auch wenn das Glück noch viel größer ist.« Jetzt habe ich mein Buch fertig, dachte ich, noch bevor wir uns in dem Gasthof auf die Veranda setzten und überlegen konnten, womit wir diesen Tag feiern wollten. Mehr als die pfingstliche Prozession des Heiligen Gesichts unter Rosenblättern und Feuerzungen würde ich nicht mehr zu sehen bekommen. Gott ist Mensch geworden und kein theologisches Lehrgebäude, sagte das Antlitz an jeder Biegung des Weges den Hügel hinab und hinauf. Wie es doch leuchtete! Das Christentum ist keine Buchreligion. »Das wundervolle Bild von Manoppello ist in der Welt und die Welt erkennt es nicht«, sagte eine Frau am Nebentisch, die mit ihrem Mann aus Hamburg zu der Prozession gekommen war. »Es ist darin zutiefst ein Christus-Bild.« Unterwegs hatte ich auch noch Fabrizio, einen jungen Mann aus Manoppello, kennen gelernt. Er sammelt seit zwanzig Jahren alle möglichen Informationen über das Heilige Gesicht und wollte sie mir alle erzählen. Doch mehr wollte und brauchte ich zu der Geschichte nicht mehr erfahren und zu hören und zu sehen bekommen als die Geschichte vom Stellvertreter – und dieses unvergleichliche Leuchten des Heiligen Gesichts in Gold und Bronze im Licht der Sonne und im Schatten der Bäume. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  Lesermeinungen
Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu |   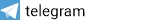  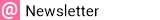 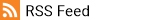  Top-15meist-gelesen
| |||||||||||
 | ||||||||||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||||||||||

