 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Argumente wider die ,Christophobie in Europa6. Mai 2006 in Aktuelles, keine Lesermeinung Joseph Weiler und George Weigel sprachen in Wien über die europäische Identitätssuche. Von Stephan Baier / Die Tagespost. Wien (www.kath.net / tagespost) Im amerikanisch-europäischen Dialog gebe es gemeinsame Probleme - Schüssel nannte die Fragen der Alterung, der Ressourcen, des Klimawandels und des Terrorismus - aber wohl auch Unterschiede in den Antworten. Zum europäischen Lebensmodell zählte der Kanzler, der auch amtierender EU-Ratspräsident ist, die soziale Marktwirtschaft und das christliche Menschenbild. Der Atlantik ist wunderschön, kann aber auch ein raues Gewässer sein. Damit leitete Schüssel über zu Joseph Weiler, den er als Jude und Nicht- Europäer vorstellte. Das wollte der in Johannesburg geborene, an der New York University und am Europakolleg in Brügge lehrende jüdische Rechtsgelehrte nicht auf sich sitzen lassen: In den USA werde er meist als europäische Stimme vorgestellt, aber in Europa als Amerikaner, meinte Weiler, der sich dies- wie jenseits des Atlantik heimisch fühlt. Zu seinem amerikanischen Blick auf die europäische Integration mag der Hinweis gehören, dass die Vereinigten Staaten während des Kalten Krieges die Verteidigung Europas finanzierten, und damit Europa ermöglichten, sich auf seine Butter zu konzentrieren. Auch mit den Vorurteilen der alten Europäer über die USA und den europäischen Versuch, Europas Identität in Abgrenzung zu Amerika zu definieren, ging Weiler hart ins Gericht: Europa werde hier als sozial, gerecht und solidarisch verstanden, Amerika dagegen als kapitalistisch und unsozial. Europa verstehe sich als multilateral und pazifistisch, während es Amerika als unilateral und militaristisch sehe. Abgesehen davon, dass es keine gute Idee sei, die eigene Identität darüber zu definieren, was man nicht ist, seien dies unzutreffende Projektionen. Weiler rechtfertigte das amerikanische Gesellschaftsmodell, betonte den hohen Stellenwert der Solidarität in Amerika und widersprach der landläufigen Kritik am unilateralen Irak-Krieg mit dem Hinweis darauf, dass die selbst dafür unfähigen Europäer im Fall des Kosovo und Bosnien-Herzegowinas die Cowboys von der anderen Seite des Atlantik herbeigerufen hätten. Auch die Modelle der Integration in Europa kritisierte Weiler: In den USA sei jeder willkommen, aber er müsse seine Kinder lehren, dass sie nun amerikanische Probleme, amerikanische Nachbarn und amerikanische Loyalitäten haben. In Europa sei ein Italiener oder Portugiese, der in Deutschland lebe, vor allem bemüht, seine und seiner Kinder italienische oder portugiesische Identität zu wahren. In seinem Buch Ein christliches Europa hatte Weiler erläutert, warum er angesichts der unterschiedlichen Verfassungstraditionen in Europa - nämlich solcher mit und ohne Berufung auf Gott - für eine invocatio Dei in der Europäischen Verfassung ist. In Wien erklärte er nun: Wenn die Hälfte der europäischen Bevölkerung unter einer nationalen Verfassung lebt, die ausdrücklich auf Gott und das Christentum Bezug nimmt, dann macht der Ausschluss eines solchen Bezugs (gemeint ist in der Europäischen Verfassung, Anm.) Europas Motto ,Einheit in Vielfalt zum Gespött. Der Ausschluss Gottes von den Symbolen des Staates und aus der gesellschaftlichen Ordnung sei keine Neutralität, sondern eine politische Entscheidung für eine Weltsicht und gegen eine andere. Weiler ortete hier eine Christophobie, die er am Fall Buttiglione nochmals darlegte: Wäre Buttiglione Jude gewesen, dann hätte ihm niemand diese Fragen gestellt und niemand seine Antworten kritisiert, meinte der Jude Weiler. Warum sollten ein Muslim oder ein Jude, als religiöse Minderheiten, sich sicher fühlen in einer Gesellschaft, die von ihren Identitäts-Ikonen die Anerkennung ihrer ureigenen religiösen Identität ausschließt? Wer seine eigene Identität nicht respektiere, könne auch die des anderen nicht respektieren. Der amerikanische Theologe und Publizist George Weigel, den Kardinal Christoph Schönborn, als Autor der bedeutendsten Biographie über Johannes Paul den Großen vorstellte, beschrieb die Rolle des gläubigen Christen im demokratischen Staat. Zunächst bezeichnete er sich als orthodox Catholic und gerade deshalb als gefährlichen Mann, dann jedoch zeigte Weigel auf, wie das Christentum Raum für Demokratie schafft: Ein wahrhaft revolutionärer Text sei jene Stelle im Matthäus-Evangelium, wo Jesus zwischen dem, was des Kaisers ist, und dem, was Gottes ist, unterscheidet. Indem er den Kaiser und Gott nebeneinander stellte und dadurch den Herrscher entgöttlichte, verkündete Jesus den Vorrang der Treue zu Gott. Jesus habe darauf bestanden, dass es Dinge gibt, die Gottes sind und nicht des Kaisers. Weil Gott Gott ist, und weil der Kaiser nicht Gott ist. Wenn der Herrscher versucht, das, was nur Gottes ist, zu okkupieren, dann müsse ihm Widerstand geleistet werden, so George Weigel. Dadurch habe das Christentum die Politik entsakralisiert: Weil der Kaiser nicht Gott ist, ist eine Zivilgesellschaft möglich. Weil er nicht Gott ist, dient der Staat der Gesellschaft - und nicht umgekehrt. Weil der Kaiser nicht Gott ist, können wir demokratische Bürger eines begrenzten Verfassungsstaates sein. So schaffe das Christentum Raum für Demokratie. Darüber hinaus leiste der christliche Personalismus, das christliche Menschenbild einen maßgeblichen Beitrag zum Funktionieren der Demokratie, durch eine Sicht des anderen als einzigartigen Subjekts, das auch Objekt des Erlösungswillens Gottes ist. Dies helfe, eben jene Art von Bürger zu formen, die eine Demokratie funktionieren lasse, meinte Weigel. Die Wurzeln der religiösen Toleranz im Amerika von heute sind weder im Pragmatismus grundgelegt noch in einer Nützlichkeitskalkulation, sondern sie sind religiöse Wurzeln. Es sei eben Gottes Wille, dass wir einander im Streit darüber, was Gottes Wille ausmache, nicht umbringen. Pluralität sei ein soziologisches Faktum, doch Pluralismus sei eine große moralisch- kulturelle Leistung, sagte Weigel. Eine Demokratie habe sich selbst, ihren Gegnern und den nachfolgenden Generationen Rechenschaft zu geben über die Wahrheit der menschlichen Person und der menschlichen Gemeinschaft, auf der sie beruht. Wenn Wahrheit demokratisiert wird - wenn also Wahrheit nicht mehr ist als der Wille jedes einzelnen von uns oder der Mehrheit - dann ist die Demokratie (unfähig letzte Rechenschaft über ihre eigene Wahrheit zu geben) ausgesetzt und nackt gegenüber ihren Feinden. Christen hätten, so meinte Weigel, eine robustere Legitimation demokratischer Herrschaft anzubieten als die meisten anderen. Die Demokratie müsse auf die moralische Gesundheit der Gesellschaft achten, damit nicht Skeptizismus und moralischer Relativismus neue Formen der Diktatur schaffen. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuEU
|  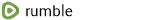 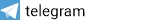 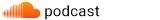 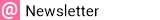 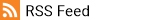 Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
