 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Auf Hoffnung hin sind wir gerettet15. Dezember 2007 in Chronik, keine Lesermeinung Gedanken zur Enzyklika "Spe Salvi" Papst Benedikts XVI. von Bischof Gerhard Ludwig Müller, Regensburg. Regensburg (www.kath.net/pdr) Gott hat uns im Glauben die Sicherheit seiner Gegenwart geschenkt und dieBewältigung der Zukunft aus der Kraft des Glauben, der Heil und Hoffnung ist.SPE SALVI facti sumus auf Hoffnung hin sind wir gerettet, sagt Paulus denRömern und uns (Röm 8,24). Die Erlösung, das Heil ist nach christlichem Glaubennicht einfach da. Erlösung ist uns in der Weise gegeben, dass uns Hoffnunggeschenkt wurde, eine verlässliche Hoffnung, von der her wir unsere Gegenwartbewältigen können: Gegenwart, auch mühsame Gegenwart, kann gelebt undangenommen werden, wenn sie auf ein Ziel zuführt und wenn wir dieses Zielsgewiss sein können; wenn dies Ziel so groß ist, dass es die Anstrengung des Wegesrechtfertigt. Nun drängt sich sogleich die Frage auf: Welcher Art ist denn dieseHoffnung, die es gestattet zu sagen, von ihr her und weil es sie gibt, seien wirerlöst? Und welcher Art Gewissheit gibt es da? Als Zentralwort des biblischen Glaubens (SS 2) sind Glaube und Hoffnung alsaustauschbare Begriffe verwendbar. Im Glauben manifestiert sich stets zugleichdie Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn am Ende der Zeiten, aber auch dieHoffnung auf die bleibende und liebende Zuwendung Gottes zu uns Menschen imAblauf unseres Lebens. Es ist nicht nur die Hoffnung auf eine verbesserteLebenssituation, sondern die grundsätzliche Hoffnung auf Erlösung. Der HeiligeVater hat ein anschauliches Zeugnis der alles verändernden Kraft der Hoffnung ausdem Glauben heraus gegeben mit der Geschichte der Sklavin Bakhita: Sie findet inJesus Christus den Herrn, der ihrem Leben den eigentlichen Sinn schenkt, weil ererlöst, befreit und ihr Hoffnung schenkt: Aber nun wird die Frage dringend: Worin besteht diese Hoffnung, die alsHoffnung Erlösung ist? Nun, der Kern der Antwort ist in der eben angeführtenStelle aus dem Epheser-Brief angegeben: Die Epheser waren vor der Begegnungmit Christus hoffnungslos, weil sie ohne Gott in der Welt waren. Gottkennenlernen den wahren Gott, das bedeutet Hoffnung empfangen. Für uns, diewir seit je mit dem christlichen Gottesbegriff leben und ihm gegenüberabgestumpft sind, ist der Besitz der Hoffnung, der von der realen Begegnung mitdiesem Gott ausgeht, kaum noch wahrnehmbar. Ein Beispiel einer Heiligen unsererZeit mag ein wenig verdeutlichen, was es heißt, diesem Gott erstmals und wirklichzu begegnen. Ich denke an die von Papst Johannes Paul II. heiliggesprocheneAfrikanerin Giuseppina Bakhita. Sie war ungefähr das genaue Datum kannte sienicht 1869 in Darfur im Sudan geboren. Mit neun Jahren wurde sie vonSklavenhändlern entführt, blutig geschlagen und fünfmal auf den Sklavenmärktendes Sudan verkauft. Zuletzt war sie als Sklavin der Mutter und der Gattin einesGenerals in Diensten und wurde dabei täglich bis aufs Blut gegeißelt, wovon ihrlebenslang 144 Narben verblieben. 1882 wurde sie schließlich von einemitalienischen Händler für den italienischen Konsul Callisto Legnani gekauft, derangesichts des Vormarschs der Mahdisten nach Italien zurückkehrte. Hier lernteBakhita schließlich nach so schrecklichen Patronen, denen sie bisherunterstanden war, einen ganz anderen Patron kennen Paron nannte sie indem venezianischen Dialekt, den sie nun lernte, den lebendigen Gott, den GottJesu Christi. Bisher hatte sie nur Patrone gekannt, die sie verachteten undmisshandelten oder bestenfalls als nützliche Sklavin betrachteten. Aber nun hörtesie, dass es einen Paron über allen Patronen gibt, den Herrn aller Herren unddass dieser Herr gut ist, die Güte selbst. Sie erfuhr, dass dieser Herr auch sie kennt,auch sie geschaffen hat ja, dass er sie liebt. Auch sie war geliebt, und zwar vondem obersten Paron, vor dem alle anderen Patrone auch nur selber armseligeDiener sind. Sie war gekannt und geliebt und wurde erwartet. Ja, dieser Patronhatte selbst das Schicksal des Geschlagenwerdens auf sich genommen undwartete nun zur Rechten des Vaters auf sie. Nun hatte sie Hoffnung nichtmehr bloß die kleine Hoffnung, weniger grausame Herren zu finden, sondern diegroße Hoffnung: Ich bin definitiv geliebt, und was immer mir geschieht ichwerde von dieser Liebe erwartet. Und so ist mein Leben gut. Durch dieseHoffnungserkenntnis war sie erlöst, nun keine Sklavin mehr, sondern freies KindGottes. Sie verstand, was Paulus sagte, wenn er die Epheser daran erinnerte, dasssie vorher ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt gewesen waren ohneHoffnung, weil ohne Gott. So weigerte sie sich, als man sie wieder in den Sudanzurückbringen wollte; sie war nicht bereit, sich von ihrem Paron noch einmaltrennen zu lassen. Am 9. Januar 1890 wurde sie getauft und gefirmt und empfingdie erste heilige Kommunion aus der Hand des Patriarchen von Venedig. Am 8.Dezember 1896 legte sie in Verona die Gelübde der Canossa-Schwestern ab undhat von da an neben ihren Arbeiten in der Sakristei und an der Klosterpforte vor allem in verschiedenen Reisen in Italien zur Mission zu ermutigen versucht:Die Befreiung, die sie selbst durch die Begegnung mit dem Gott Jesu Christiempfangen hatte, die musste sie weitergeben, die musste auch anderen, möglichstvielen, geschenkt werden. Die Hoffnung, die ihr geworden war und sie erlösthatte, durfte sie nicht für sich behalten; sie sollte zu vielen, zu allen kommen.Worin besteht diese Erlösung? Ist es eine Befreiung von politischer Herrschaft, einRuf nach grenzenloser Autonomie oder das menschliche Verlangen nach demChaos der Anarchie? Geht es um die Ablehnung bestehender sozialer, politischeroder ethischer Verpflichtungen? Und münden diese Formen nicht dennoch alle imEgoismus, in der Selbstherrlichkeit selbsternannter Befreier und Erlöser? Die Botschaft des Hoffnung schenkenden Glaubens ist eine andere: Was Jesusgebracht hatte ist etwas ganz anderes. Er starb selbst am Kreuz für uns und hatuns hineingestellt in die Begegnung mit dem Herrn aller Herren, dem lebendigenGott, dem Gott der Hoffnung und des Lebens. Sein Tod ist Hoffnung. Weil erstärker war als die Sklaverei, die Unterdrückung, das Leiden, deshalb hat er dieWelt verändert und sie zur Liebe umgestaltet. Ein Gott, der am Kreuz für uns gestorben ist, ist auch kein rein kosmischesElement, das den Gesetzen der Materie unterworfen ist. Er selbst herrscht über dieSterne und über das All. Und die unerbittliche Macht der Materie ist nicht mehrdas letzte Wort. Wir begegnen einer Person, der Liebe, dem Willen zur Erlösungund die Hoffnung auch dem Vereinsamten, dem Sterbenden und demVerachteten gibt. Ewiges Leben? Das Leben selbst im Hier und Jetzt erhält zugleich eine neue Dimension. Es istaus der Enge irdischer Begrenzung herausgelöst. Wir kennen das Dilemma: Wirwollen nicht sterben, aber auch nicht ewig leben. Aber was ist das, das EwigeLeben? Einerseits wollen wir nicht sterben, will vor allem auch der andere, der uns gutist, nicht, dass wir sterben. Aber andererseits möchten wir doch auch nicht endlosso weiterexistieren, und auch die Erde ist dafür nicht geschaffen. Was wollen wiralso eigentlich? Diese Paradoxie unserer eigenen Haltung löst eine tiefere Frageaus: Was ist das eigentlich Leben? Und was bedeutet das eigentlich Ewigkeit?Es gibt Augenblicke, in denen wir plötzlich spüren: Ja, das wäre es eigentlich daswahre Leben so müsste es sein. Daneben ist das, was wir alltäglich Lebennennen, gar nicht wirklich Leben. Augustinus hat in seinem an Proba, eine reicherömische Witwe und Mutter dreier Konsuln, gerichteten großen Brief über dasGebet einmal gesagt: Eigentlich wollen wir doch nur eines das glücklicheLeben, das Leben, das einfach Leben, einfach Glück ist. Um gar nichts anderesbeten wir im Letzten. Zu nichts anderem sind wir unterwegs nur um das einegeht es. Nur um das eine geht es: Dass wir in Gott den Zielpunkt unseres Lebens erkennen,das Eintauchen in den Ozean der unendlichen Liebe, in dem es keine Zeit, keinVor- und Nachher mehr gibt. (SS 12) Es ist die Rückkehr zu Gott, der uns freudigempfängt, wie es der Johannesevangelist beschreibt: Ich werde euchwiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude wird niemand voneuch nehmen (Joh 16, 22). Das Thema des Papstbesuches im vergangenen Jahr lautete Wer glaubt, ist nieallein. Darin hat sich die gemeinschaftliche Sicht der Erlösung, des wahren Lebensausgedrückt. Wir sind keine isolierten Individuen und Erlösung bedeutet nicht dieBetonung einer Vorrangstellung vor dem anderen. Heil in Christus betrifft alle Menschen. Er macht ihnen das Angebot des Heils undverkündet seine Botschaft durch die Kirche. Und die Kirche ist die weltweiteGemeinschaft der Gläubigen, die bereits in ihrer sichtbaren Erscheinung zurEinheit führt. Als Werkzeug in den Händen Christi verweist die Kirche zugleich auf das seligeLeben, das die gegenwärtige Welt übersteigt. Und sie ist Abbild der Einheit, die inder Ewigkeit ihre Vollendung durch Gott selbst findet. Neuzeitliche Formen von Erlösung Wenn der Faktor Gott vom Menschen in die reine Innerweltlichkeitheruntergezogen wird und seine Existenz geleugnet wird, wird die Leere spürbar,die sich in seinem Inneren ausbreitet. Philosophisch hat Kant den Versuchunternommen, das Christentum als reines ethische Postulat gelten zu lassen. Nurdie moralischen Grundlagen können innerweltlich vertretbar sein und zumMaßstab eines gelingenden Miteinanders herangezogen werden. Ein Katalog, einRegelwerk ethisch-moralischer Gesetze würde das Reich Gottes auf Erdenerrichten. Gott selbst ist dabei nicht notwendig. Er hindert den aufgeklärten Menschen zusich selbst zu kommen und hält ihn als Gefangenen in der eigenen Unmündigkeit.Hier ist jede Hoffnung auf Heil und Erlösung, die den Menschen wirklich zumLeben führt, einer Konstruktion von Gesellschaft gewichen. Noch deutlicher sind die politischen Erlösungstheorien von Engels und Marx. Imindustriellen Fortschritt findet der Mensch, der Arbeiter zu seiner Bestimmung. DasReich Gottes wurde innerweltlich etabliert. Im genauen Ablauf derGeschichtsnotwendigkeit wird der Arbeiter zum Ideal der an den wirtschaftlichenAbläufen orientierten Gesellschaft. Eigentum wird überführt an den Staat, dieherrschende Klasse wurde enteignet, die politische Macht gestürzt dieRevolution hat Erlösung und Befreiung geschenkt. Um welchen Preis? DasUnmenschliche liegt in der Reduzierung des Menschen auf ein Segment imwirtschaftlichen Fortschritt, der sich, um Mensch zu sein, den Mechanismen derProduktion zu unterwerfen hat. Aber das wahre Reich Gottes ist Geschenk. Es ist immer mehr als wir verdienen.Die Ideologien der Menschen waren und sind am eigenen Vorteil ausgerichtet,auch wenn sie Freiheit, Selbstbestimmung und Erfolg versprechen. Aber derMitarbeiter Gottes versucht Gott den Weg in die Welt zu eröffnen. Das Lebenwird hoffnungslos, wenn nur das Erreichbare zum Ziel wird. Die menschlichenReiche haben vergessen, wer der Mensch ist: Nämlich als Geschöpf Gotteszugleich auf die Vollendung durch ihn hin geschaffen. Nicht der Mensch erfülltdiese Hoffnung, sondern nur Gott allein. Die neu gewonnene Freiheit, die ohne Ordnung in die Zukunft ging, brachteVerderben, Knechtschaft und Unterdrückung und die ungebremste Herrschaft derPartei. Was war falsch an den politisch motivierten und in einer literarischen Formso harmlos daherkommenden Vision eines Marx? Er hat vergessen, dass der Mensch immer ein Mensch bleibt. Er hat den Menschenvergessen, und er hat seine Freiheit vergessen. Er hat vergessen, dass die Freiheitimmer auch Freiheit zum Bösen bleibt. Er glaubte, wenn die Ökonomie in Ordnungsei, sei von selbst alles in Ordnung. Sein eigentlicher Irrtum ist der Materialismus:Der Mensch ist eben nicht nur Produkt der ökonomischen Zustände, und man kannihn allein von außen her, durch das Schaffen günstiger ökonomischerBedingungen, nicht heilen. Wir kennen viel Formen der Hoffnung. Jeder Tag ist angefüllt damit und jedeLebenssituation kennt eine andere: In jungen Jahren ist die Hoffnung nach einerberuflichen Erfüllung, nach Liebe und nach einer Familie prägend. Schnell zeigt sich aber, das dies nur dann in seiner Bedeutung erfahrbar wird,wenn die Hoffnung ausgreift auf etwas, das über dem Endlichen steht und das derzeitlichen Begrenzung enthoben ist. Etwas, was den Menschen übersteigt.In diesem Bezugspunkt zu einem persönlichen Gott wird auch die Familie, derBeruf, die Bildung und das kirchliche und soziale Engagement zu Mitteln, die dieWelt verändern. Die kleinen Hoffnungen des Alltags, die uns auf dem Weg halten, brauchen diegroße Hoffnung, die alles überschreitet. Und diese Hoffnung kann nur Gott selbstsein, der das Ganze umfasst, der uns geben und schenken kann, der uns im Liebenund Erlösen Hoffnung schenkt auf das wahre Leben. Das Gebet als Schule der Hoffnung Ein erster Lernort der Hoffnung ist das Gebet. Wenn niemand mehr zuhört, wennich zu niemandem mehr reden kann in dieser Verlorenheit bleibt mir immer Gott.Als Betender ist der Mensch nie allein. Beten bedeutet dabei aber nicht, den eigenen Vorteil zu suchen. Es schließt unsnicht aus von der Geschichte, es isoliert uns nicht vom Anderen. Denn rechtesBeten ist ein Vorgang der inneren Reinigung, der uns gottfähig und so gerademenschenfähig macht. Rechtes Beten ist eine persönliche Begegnung meines Ich mit dem lebendigenGott, das aber in das gemeinschaftliche Gebet der Kirche mündet: In dasVaterunser, in das Ave Maria und in die Gebete der Liturgie.So können wir mit Gott wirklich sprechen, so redet Gott mit uns. Aus dieserBegegnung erwächst die Reinigung, die uns zu hoffenden Menschen werden lässt.Hoffnung, die die Welt für Gott offen hält. Tun und Leiden als Schule der Hoffnung Alles ernsthafte und rechte Tun des Menschen ist Hoffnung im Vollzug. Wirringen um die Erfüllung unserer Ziele und Hoffnungen, wir tragen dazu bei, dassdie Welt ein wenig menschlicher wird und sich auf diese Weise Türen öffnenlassen für eine hoffnungsvolle Zukunft. Wenn wir nicht mehr hoffen oder uns auf rein weltliche Mächte konzentrieren,dann sind wir bald ohne Hoffnung. Nur die große Zuversicht, dass trotz desvielfältigen Scheiterns mein Leben geborgen ist in den Händen Gottes und von ihmher Sinn, Mut zum Wirken und Kraft zum Weitergehen erhält, lehrt uns dieHoffnung, in der wir gerettet werden. Aber auch das Leid gehört zu unserem Leben und ist ein Lernort der Hoffnung. Dasungerechte Leid, die eigene Endlichkeit, die Qualen die viele erleiden müssen, siewandeln sich in Freude, weil Gott befreit, der Angst und Trauer verwandelt inHeiterkeit und Freude Er ist ein Gott der Tröstung, der con-solation, des MitSeinsin der Einsamkeit. Mit dieser Hoffnung werden wir herausgeführt aus demLeid, das so viele verschiedene Formen annehmen kann. Das Gericht Übung in der Hoffnung Und als dritten Lernort der Hoffnung nennt Benedikt XVI. das Gericht. Er wirdwiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten, so schließtim großen Glaubensbekenntnis der Mittelteil, der das Geheimnis von der ewigenGeburt aus dem Vater und von der zeitlichen Geburt aus Maria der Jungfrau überKreuz und Auferstehung bis zu seiner Wiederkunft behandelt. Der Ausblick auf dasGericht hat die Christenheit stets zum Maßstab des gegenwärtigen Lebens, alsAufforderung an das Gewissen und als Zeichen der Hoffnung auf die GerechtigkeitGottes bestimmt. Es ist nicht das Szenario der Furcht, sondern das Bild derVerantwortung (SS 44). Es ist ein Blick nach vorne, der dem Christentum seine Gegenwartskraft gibt undzugleich das Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit schenkt. Es gibt Gerechtigkeit, esgibt die Gutmachung, das Recht und die Auferstehung des Fleisches Daher istder Glaube an das Letzte Gericht zuallererst Hoffnung auf den alles zum gutenwendenden Gott. Nicht irgendein Gott, der sich unseren Blicken entzieht, ist unsere Hoffnung undErlösung, sondern der Gott Jesus Christus, der uns sein Angesicht geschenkt hat,der uns an Weihnachten den Frieden und das Heil gebracht hat.Mit Maria stellen wir uns vor Jesus Christus. Sie ist der Stern der Hoffnung, weilsie Gott die Tür geöffnet hat- zu ihrem Herzen und zur ganzen Welt. Sie hat Ja zurHoffnung gesagt. Zu der Hoffnung, auf die hin wir gerettet sind. Darum rufen wir zu ihr: Heilige Maria, du gehörtest zu jenen demütigen undgroßen Seelen in Israel, die wie Simeon auf den Trost Israels warteten (Lk2,25), wie Anna auf die Erlösung Jerusalems hofften (Lk 2,38). Du lebtest in denheiligen Schriften Israels, die von der Hoffnung sprachen von der Verheißung,die Abraham und seinen Nachkommen geschenkt war (vgl. Lk 1, 55). So verstehenwir das heilige Erschrecken, das dich überfiel, als der Engel Gottes in deine Stubetrat und dir sagte, du sollest den gebären, auf den Israel hoffte, auf den die Weltwartete. Durch dich, durch dein Ja hindurch sollte die Hoffnung der JahrtausendeWirklichkeit werden, hineintreten in diese Welt und ihre Geschichte. Du hast dichder Größe dieses Auftrags gebeugt und ja gesagt: Siehe, ich bin die Magd desHerrn; mir geschehe nach deinem Wort (Lk 1,38). Als du in der heiligen Freudeüber die Berge Judäas zu deiner Base Elisabeth eiltest, wurdest du zum Bild derkommenden Kirche, die die Hoffnung der Welt in ihrem Schoß über die Gebirgeder Geschichte trägt. Aber neben der Freude, die du in deinem Magnificat in dieJahrhunderte hinein gesagt und gesungen hast, wußtest du doch auch um diedunklen Worte der Propheten vom Leiden des Gottesknechtes in dieser Welt. Überder Geburt im Stall zu Bethlehem leuchtete der Glanz der Engel, die den Hirten diefrohe Kunde brachten, aber war doch zugleich auch die Armut Gottes in dieserWelt nur allzu spürbar. Der greise Simeon sprach dir von dem Schwert, das deinHerz durchdringen werde (vgl. Lk 2,35), vom Zeichen des Widerspruchs, das deinSohn sein werde in dieser Welt. Als dann das öffentliche Wirken Jesu begann,musstest du zurücktreten, damit die neue Familie wachsen konnte, die zu gründener gekommen war und die aus denen wachsen sollte, die sein Wort hörten und esbefolgten (vgl. Lk 11,27 f.) Spe Salvia> Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal! LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuSpe Salvi |       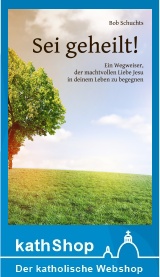 Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||

