 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:   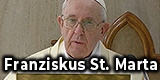  Top-15meist-diskutiert
|  Meisner: 'Indem ich niederknie vor seiner Gegenwart '2. November 2015 in Spirituelles, 4 Lesermeinungen Kardinal Meisner hielt an Allerheiligen einen Vortrag über die hl. Eucharistie - Vortrag in voller Länge auf kath.net! Köln (kath.net/pek/pl) Wer kann ein solches Mysterium begreifen, dass da einer ist, der wie ein Stück Brot aussieht und doch der Herr seiner Kirche ist? Das fragte der emeritierte Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meisner (Archivfoto), in seinem Vortrag über die Heilige Eucharistie in der Vesper des Allerheiligenabends im Kölner Maternushaus. In der Kapelle des Maternushauses wird auf Wunsch des Kardinals seit Ende 2013 Tag und Nacht eucharistische Anbetung gehalten, was Meisner bei seiner Verabschiedung als Erzbischof von Köln als sein Vermächtnis bezeichnete, kath.net hat berichtet. kath.net dokumentiert den Vortrag Über die heilige Eucharistie des emeritierten Erzbischofs von Köln, Joachim Kardinal Meisner, in der Maternushauskapelle am 1. November 2015 in voller Länge 1. Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der Welt. Mit diesen Worten spricht der Priester den Einladungsritus zum Kommunionempfang bei jeder Messe. Das ist aber nicht nur ein Einladungsritus zum kommunizieren, sondern es ist auch ein einzigartiger Einladungsgestus zur Anbetung des Herrn im Sakrament der Eucharistie. Darum wechselt die Kirche oft die Hand des Priesters mit der Monstranz aus, um die Anbetung der heiligen Eucharistie zu ermöglichen. Denn dieses Brot ist keine Sache mehr, kein Neutrum, kein Es, sondern dieses Brot ist ein Du, eine Person. Es ist Jesus Christus selbst. Vor der konsekrierten Hostie bekennt die Kirche mit Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes (Mt 16,16). Und darum sagt uns Paulus das ernste Wort: Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt (1 Kor 11,27-29). Die Kirche macht sich das Wort des Apostels Thomas im Sakramentshymnus zu Eigen, indem sie vor der weißen Hostie bekennt: Mein Herr und mein Gott! (Joh 20,28). Ich meine, vielleicht wussten frühere Generationen lebendiger als wir heutigen, dass uns in der Eucharistie Christus, der Herr, selbst auf ganz persönliche Weise begegnet und er auf die Begegnung mit uns wartet. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt (Jer 31,3), so lautet seine Einladung an uns. Darum konnten unsere Vorfahren jahrhundertelang ihre Kirchen offen halten, ohne dass sie bestohlen oder missbraucht wurden, weil sie von innen her offen waren durch die vielen Beter, die tagsüber vor dem Tabernakel in Anbetung und Danksagung knieten. Im Jahre 1982 starb in Berlin der bedeutende Gelehrte Eduard Winter. Er war Philosophieprofessor und hatte in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sein Priestertum aufgegeben. Er schloss sich dann dem Nationalsozialismus an. Und später, als dieser vorüber war, dem kommunistischen System und war dann innerhalb der DDR an der Martin-Luther-Universität in Halle Professor. Ich versuchte durch einen Besuch bei ihm, ihm wieder einen Weg zur Kirche zurückzubauen. Dabei sagte er mir: Wenn ich nur lebendig genug an die persönliche Gegenwart des Herrn in der Eucharistie geglaubt hätte, wäre mein Leben anders verlaufen. Und er fügte hinzu: Wenn die katholische Kirche glühend an diese Gegenwart des Herrn in der Eucharistie glaubt, dann dürfte sie eigentlich über ihre eigenen Probleme nicht mehr reden. In unserer großen Erzdiözese Köln gibt es gleichsam ein permanentes Fronleichnamsfest in der so genannten Feier des Ewigen Gebetes. An jedem Tag des Jahres übernimmt eine Pfarrgemeinde die Anbetung der Eucharistie von früh bis abends. Und in der Nacht geschah es früher in den Klöstern, als wir noch genügend Klöster besaßen. Ich persönlich war als Bischof von Berlin glücklich, dass wir ein kleines Kloster St. Gabriel in der Bayernallee hatten, in dem die Steyler Anbetungsschwestern Tag und Nacht Anbetung vor dem eucharistischen Herrn gehalten haben. Seit 1930 tun sie diesen Dienst für das Volk Gottes. Sie haben in den Bombennächten des 2. Weltkrieges durchgehalten und in allen Turbulenzen der Nachkriegszeit. Die Vitalität unseres Glaubens bemisst sich nach der Intensität unserer eucharistischen Anbetung. Es ist nicht von ungefähr, dass neue Ordensniederlassungen, wie etwa die Missionarinnen der Liebe von unserer Mutter Teresa von Kalkutta oder die Fraternitäten der Kleinen Schwestern oder die Laienbewegungen von Taizé in ihrer Mitte die eucharistische Anbetung sehr intensiv und extensiv pflegen. Es macht mich immer zutiefst traurig, einen gefüllten Tabernakel mit dem Ewigen Licht davor in einer verschlossenen Kirche zu erleben. Die Sehnsucht des Herrn nach Begegnung ist hier zur Vergeblichkeit verurteilt. Mit großer Ergriffenheit denke ich an meine thüringische Heimatgemeinde, die erst 1945 aus lauter Flüchtlingen gegründet wurde. Bis 1979 hatten wir kein eigenes Gotteshaus, keine Kirche und keine Kapelle. Bei jeder heiligen Messe mussten die übrig gebliebenen Hostien gleich verspeist werden, denn wir hatten keinen Tabernakel. Und dann lief wieder alles auseinander. Nun war es uns endlich möglich, eine schlichte Kirche zu bauen. Ich fühle noch heute die Freude bei der Kirchweihmesse, als wir nach der Kommunion die übrig gebliebenen konsekrierten Hostien zum ersten Mal nicht verspeisen mussten, sondern in den Tabernakel zurückstellen konnten. Und dabei wurde das Ewige Licht entzündet, und die Gemeinde betete bewegten Herzens: In Demut bete ich dich, verborgene Gottheit, an. Nach dem Gottesdienst sagte mir ein Mann, ein alter Berufssoldat, den wir alle sehr schätzten: Nun kann ich ruhig sterben, denn der Herr wohnt leibhaftig in unserer Mitte und segnet von hier aus auch unsere Gräber. 2. Immer, wenn wir bei der heiligen Messe sagen: Seht, das Lamm Gottes!, wird eine Brücke von der irdischen Kirche zur himmlischen Kirche geschlagen, von der wir in der Apokalypse lesen: Das Lamm steht auf dem Thron, um ihn herum die vier lebenden Wesen und die vierundzwanzig Ältesten, die vor dem Lamm niederknien und rufen (vgl. Off 5,6-11): Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob (Off 5,12). So oft wir dieses Brot, das Lamm Gottes, anbeten, wird die Brücke zu dieser himmlischen Liturgie geschlagen. Wenn die himmlische Kirche und die irdische Kirche deckungsgleich sind, dann ist unsere Kirche wirklich authentisch Kirche Jesu Christi und damit ein Zeichen des Heils für die Menschen in unserer Stadt und in unserem Land. Gott geht in der heiligen Eucharistie seinen Weg zu uns. Das ist aber auch mein persönlicher Weg zu ihm. Der auferstandene Christus ist mir bis auf die Schwelle des Todes entgegen gekommen. Nun brauche ich nur einen kleinen Schritt auf ihn hinzutun, indem ich niederknie vor seiner Gegenwart in der Monstranz oder im Tabernakel. Das ist ein ganz persönlicher Vorgang. Es ist bedeutsam, dass etwa die Liturgiefeier der Eucharistie kurz vor der Kommunion aus dem liturgischen Wir überwechselt in das persönliche Ich: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Und der Apostel Paulus gibt dem Einzelnen die Mahnung: Darum prüfe sich der Mensch, bevor er isst und trinkt, damit er sich nicht das Gericht isst und trinkt. Die heilige Kommunion und die eucharistische Anbetung sind durch das Ich-Gebet geprägt. Die eucharistische Kommunion ist oft zu oberflächlich, weil uns eine Weile der persönlichen Stille fehlt. Nur wenn das Gebet und das Bekenntnis des Apostels Thomas: Mein Herr und mein Gott!, zu meinem persönlichen Gebet und meinem persönlichen Bekenntnis wird, dürfen wir dann auch legitim beten: Mein Herr und mein Gott!. Die Kirche zeigt uns in der heiligen Eucharistie ein Brot, in dem sich buchstäblich Gott selbst an die Menschen verschenkt hat. Wer kann ein solches Mysterium begreifen, dass da einer ist, der wie ein Stück Brot aussieht und doch der Herr seiner Kirche ist. Gott ist in der heiligen Eucharistie als Nahrung des Menschen, aber ihn auch seiner Freundschaft gewiss werden zu lassen. Da erhebt sich die Frage: Der Mensch soll doch für Gott da sein, aber nicht umgekehrt. Hier im Sakrament des Altares ist aber Gott für die Menschen da. Hier lebt der Mensch wirklich durch Gott, indem er auf ihn blickt und sich an ihm orientiert. Wer das begreift, der kann nur staunen, danken, loben und anbeten. Das tut die Kirche, solange der Herr in der Eucharistie in unserer Mitte ist: Wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Nicht Gebot, sondern Ehrfurcht, nicht Pflicht, sondern Begeisterung locken die Christen vor unsere Altäre mit dem Herrn in der Monstranz. Wer dieses eucharistische Brot gläubig anschaut, erfährt bis in sein leibliches Dasein hinein, dass Gott den Himmel zugunsten der Menschen verlassen hat. 3. Gott ist einer, der wirklich bei den Menschen sein will. Das erfahren wir unleugbar in der heiligen Eucharistie. Hier enthüllt sich Gott als einer, der alles für die Seinigen tut: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt (Joh 15,13). Er hat das nicht nur gesagt, sondern auch getan! Er ist wirklich der Gebende und die Gabe selbst. Am Gründonnerstag hat Jesus das Brot in die Hand genommen und es den Jüngern gegeben: Das ist mein Leib für euch!. Er hat sich damit selbst in die Hand genommen und sich den Menschen ausgeliefert: Hier bin ich! - Nehmt mich! Schaut mich an! Nehmt euren Platz neben mir ein!. Und sie haben ihn genommen: am Gründonnerstag und am Karfreitag. Das ist ein Geschehen, die Hingabe des Herrn für uns in der eucharistischen Form und in der Passion. Die Eucharistie ist das Kreuz, und das Kreuz ist die Eucharistie. Wenn wir das eucharistische Brot in der Monstranz auf unsere Altäre stellen, dann steht das Kreuz mit dem geopferten und auferstandenen Christus direkt vor uns. Die eucharistische Anbetung ist die reale Fortsetzung der Kreuzesverehrung des Karfreitags. Ich bin sehr dankbar, dass wir in der Kapelle des Maternushauses ein permanentes Fronleichnam in Köln haben, indem hier lückenlos die eucharistische Monstranz Tag und Nacht zur Anbetung ausgestellt ist. Wir können dankbar sein, dass wir im Erzbistum Köln ungefähr 800 Tabernakel mit der heiligen Eucharistie haben, die wie ich hoffe wenigsten ab und zu angebetet und verherrlicht wird. Der Herr ist leibhaftig unter uns! Was ist der Leib? Das ist der ganze Mensch, mit Leib und Seele! Wo der Leib ist, da ist der Mensch. Durch den Leib existiert der Mensch an diesem Ort und in dieser Zeit. Durch den Leib kann der Mensch sich mitteilen und verschenken. Der Leib, das ist der Mensch. Jesus nimmt das Brot und sagt: Das ist mein Leib für euch (Lk 22,19). Damit dürfen wir uns nicht abfinden. In dieser Stunde, die seinen Tod schon vor-wegnimmt und deutet, zeigt Jesus das Maß der Liebe Gottes zum Menschen. Als Jesus seinen Jüngern das Brot reichte, gab er sich damit ganz aus der Hand. Er verschenkte sich ganz, nicht nur damals, sondern auch heute. Tut dies zu meinem Gedächtnis! (Lk 22,19), das ist seine ausdrückliche Einladung zur immerwährenden Anbetung vor der Monstranz. Das ist sein Vermächtnis an uns. Darum bleibt er ja bei uns Tag und Nacht, weil er uns immer zur Verfügung stehen will. Wie kann ich dieser ausgestreckten Hand des Herrn begegnen? Nur so, dass ich mich vor ihm in der heiligen Eucharistie einfinde, dass ich ihn anschaue, dass ich auf ihn höre, dass ich ihm mein Herz öffne, dass ich seine Anliegen für die Welt zu meinem Anliegen vor ihm mache. Ich möchte ihn in der Anbetung in mich aufnehmen, von ihm leben und mich ihm geben. Wenn der Priester die Worte Jesu über Brot und Wein spricht: Das ist mein Leib, das ist mein Blut, handelt Jesus an diesen Gaben: Brot und Wein werden mit dem Worte Jesu verbunden und in den Leib und das Blut Christi verwandelt. Wenn diese gewandelten Gaben vor uns stehen und wir uns vor seinem eucharistischen Brot einfinden, dann setzt sich seine Umwandlung in uns fort, nicht nur das Brot ist verwandelt worden, sondern auch alle, die vor ihm niederknien und ihn anbeten. Und so, wie Menschen durch ihren Leib handeln und reden und an bestimmten Orten gegenwärtig sind, so ist Jesus durch die heilige Eucharistie, die sein Leib geworden ist, gegenwärtig an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit: segnend, redend, ermutigend und liebend. So wie Gott seinen Sohn dahingab in der heiligen Eucharistie zur Erlösung der Welt, so mutet er dann auch uns zu, ein Stück unseres eigenen Lebens herzugeben. Auf diese Weise kommt Christus durch die Anbetung in eine Welt, die ihm sonst verschlossen blieb. Er kommt durch uns in unsere Straßen, in unsere Häuser. 4. Unser Gott ist nicht ein Gott der Sparsamkeit, sondern der Verschwendung. Das sieht man in der Schöpfungsordnung. Wenn im Frühling die Bäume blühen, dann sind sie überschüttet von Hunderttausenden von Blüten, obwohl nur einige Hundert zur Fruchtbarkeit kommen. Dasselbe ist erkennbar in der Erlösungsordnung: Wenn Gott uns etwas gibt, dann gibt er eigentlich nicht etwas, sondern immer sich selbst. Eines der ergreifendsten und unbekanntesten Gottesbilder des Neuen Testamentes ist das Bild von der armen Witwe am Opferstock im Tempel von Jerusalem. Niemand bemerkt sie, nur Christus selbst, indem er seinen Jüngern sagt: Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle andern. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben; diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt (Mt. 12,43). So ist Gott in der Eucharistie. Er hat in den Opferkasten in dieser Welt nicht etwas von seinem Überfluss hineingeworfen, sondern sein Ein und Alles, seinen Sohn Jesus Christus. Mehr hat er nicht zu vergeben. Wenn wir vor der kleinen weißen Hostie das Knie beugen, die materiell fast ein Nichts ist, selbst die Briefwaage gibt ihr Gewicht nicht an, aber sie ist Gottes Ein und Alles. Mehr hat er uns nicht zu geben. Nicht ein Etwas, sondern sein Alles. Und das ist sein Sohn Jesus Christus in der heiligen Eucharistie. Und deshalb sagt der Apostel Paulus: dass ihr in allem reich geworden seid in ihm (1 Kor 1,4-5). Sind wir uns dieses Reichtums immer bewusst? Mir erzählte ein polnischer Pfarrer von einer alten Dame, die er auf den Tod vorbereitete und die er in äußerster Dürftigkeit und Armut antraf. Lebenslang hatte sie einem sehr reichen, unverheirateten Mann den Haushalt geführt. Und als er sie fragte, ob er, der Reiche, nicht für ihr Alter und ihre Krankheit gesorgt hat, sagte sie: Er hat mir einen sehr netten Brief geschrieben, und sie reichte ihm einen Umschlag. Und in diesem Umschlag steckte ein Scheck mit einer ungeheuren großen Summe und ein Testament, das sie zur Universalerbin einsetzte. Aber diese Frau war eine Analphabetin. Sie konnte nicht lesen. Sie wusste nicht, wie reich sie war. Mir scheint diese Begebenheit so ergreifend, weil sie auch etwas über uns selbst aussagt. Sind wir nicht alle auch oft religiöse Analphabeten, dass wir Christi Reichtümer in der heiligen Eucharistie gar nicht erfassen und begreifen können? In ihm sind wir in allem reich geworden, wenn wir vor der heiligen Hostie niederknien, materiell fast ein Nichts, aber Gottes Ein und Alles. Mehr konnte er uns nicht geben! Friedrich Engels sagte im Hinblick auf den Menschen: Der Mensch ist das, was er isst, nämlich nur Materie. Das stimmt sicher nicht. Aber der Christ ist im Hinblick auf die Eucharistie das, was er isst. Wir essen den Leib Christi. Darum werden wir zum Leibe Christi. Und dieser Leib Christi ist täglich sichtbar auf unseren Altären in unseren Kirchen. Ein KZ-Häftling berichtet, dass er zur Strafe tagelang in einer Einzelzelle im Keller saß. Er konnte durch das Kellerfenster auf die asphaltierte Lagerstraße sehen. Jeden Morgen und jeden Abend sah er unzählige Füße im Gleichschritt daher trotten, sich einem fremden Willen beugend. Das ist fast ein Bild für die Situation der Menschen in unserer Welt. Sie trotten im Gleichschritt der Tritte gedankenlos über die Straßen der Welt. Bei uns Christen soll es aber anders sein! Wir haben Christus in unserer Mitte, der uns sein Ehrenwort in der Eucharistie gegeben hat, indem er sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt (Mt 28,20). Und darum ist ein Christ auch nicht von fremden Willen fernsteuerbar oder ferngelenkt. Wir haben den Herrn in unserer Mitte, der die Richtung für unseren Weg angibt, der seine Spuren auch im rheinländischen Sand hinterlassen hat, sodass wir nur in seine Spuren zu treten brauchen und darum gleichsam zum Spurensicherungskommando für unsere Mitmenschen werden, die ebenfalls in die Spuren Christi gelangen müssen, damit sie den Weg zum himmlischen Vater nicht verfehlen. 5. Unser Rheinland ist nicht Gott-verlassen, unserer Rheinland ist eine Gott-verbundene Gegend, indem der eucharistische Herr leibhaftig Einer unter uns ist. Die heilige Eucharistie zeigt uns: Es gibt keinen leiblosen Christus und folglich keinen weltlosen Gott und darum keine gottlose Welt. Wer im privaten und im gesellschaftlichen Leben Gott theoretisch oder praktisch ausklammert, der führt sich und die Menschen am Sinn des Lebens vorbei. Der Schöpfungsbericht lässt den von Gott ins Paradies gesetzten Adam nach einem Partner auf die Suche gehen, nach einem Partner, dem er sein Du schenken kann. Und er findet immer nur Tiere vor. Es kommt ihm dabei nicht das Du über die Lippen, sondern immer nur die Namen für die Tiere, bis ihm plötzlich die Eva gegenübertritt und er in den Ruf ausbricht: Das ist Fleisch von meinem Fleisch. Das ist Gebein von meinem Gebein. Und er schenkt ihr sein Du. Der Herr sagt uns mit dem Geheimnis der Eucharistie: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm (Joh 6,56). Durch die Eucharistie werden wir Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein. Der Herr identifiziert sich mit uns, sodass wir für Gott Partner werden, wie sein Sohn, sodass er auch uns sein Du-Wort schenkt. Und das geschieht in der eucharistischen Anbetung. Der Herr schenkt uns sein Du und erwartet unsere Antwort. Die Herzmitte unserer Kirche ist der eucharistische Herr. Die Gegenwart Christi im Altarsakrament zu suchen und in seiner Gegenwart zu verweilen, das ist weit mehr als eine bloße Gebetsgeste. Es heißt, sich der über-natürlichen Strahlungskraft der heilenden Liebe Gottes auszusetzen, die Jesus erfüllt, Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes (Kol 2,9), wie der Apostel Paulus sagt. Seinem Bild sollen wir gleichgestaltet werden. Seine Herrlichkeit sollen wir widerspiegeln. Wir treten in diese Gegenwart des Herrn ein, wenn wir vor dem Tabernakel oder der Monstranz niederknien. Es ist kein gutes Zeichen, wenn unsere Kirchen außerhalb der Eucharistiefeiern leer bleiben. Ich frage mich oft: Wie kommt das nur, dass die Kirchenbänke leer bleiben, obwohl die Tabernakel voll sind?. Ich frage mich selbst: Reden wir als Priester zu wenig davon?. Dieses Schweigen unsererseits wäre ohrenbetäubend für das Volk Gottes. Es wüsste nicht mehr, dass es ein eingeladenes Volk, ein vom Herrn erwartetes Volk ist. Ob wir nicht als Familiengemeinschaften, als kleine Gruppen oder als Einzelne öfter zu einer Anbetung in unsere Maternushauskapelle finden. Christus identifiziert sich mit uns in der heiligen Eucharistie. Nun sollen wir uns mit ihm identifizieren. Diese Einladung an die anderen Mitchristen auszurichten, ist unsere Berufung und unsere Sendung. Amen. + Joachim Kardinal Meisner Kardinal Meisner Katechese (Eucharistischer Kongress) 6. Juni 2013 Was ist eucharistische Anbetung ganz praktisch? Archivfoto Kardinal Meisner (c) kath.net/Petra Lorleberg Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuEucharistie
|       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||


